Zur Person: Christian Jeltsch
- 1958 in Köln geboren
- Nach seinem Studium in den Bereichen Psychologie und Theaterwissenschaften arbeitete er zunächst als Regieassistenz
- Wechselte ins Fach des Drehbuchschreibens und gewann dafür unter anderem den Adolf-Grimme-Preis (für «Einer geht noch …»), den Bayerischen Fernsehpreis (für «Rot Glut») und den deutschen Fernsehpreis (für «Bella Block – Das Glück der Anderen»)
- Schrieb bereits für mehrere «Tatort»-Teams sowie für diverse «Polizeiruf 110»-Ermittler
Das geht bei mir tatsächlich nach Bauchgefühl. Die Ausnahme ist, wenn ich wie neulich für Dortmund erstmals für ein Team schreibe. Dann schaue ich mir die vorherigen Fälle an, sofern ich sie nicht schon gesehen habe, und achte darauf, wie die Figuren geführt sind. Gerade bei Dortmund ist das wichtig, weil dort eine horizontale Geschichte erzählt wird. Da muss man sich schon sehr genau informieren. Aber bei Teams, für die ich schon einmal geschrieben habe, geht es nach Bauchgefühl, das einem etwa auch sagt, ob die Idee zu den Figuren passt. Das ist besonders wichtig. Denn als «Tatort»-Autor sollte man schon wissen, mit welcher Geschichte man zu welchem Team und zu welchem Sender geht.
Ich als Zuschauer muss gestehen, teilweise Probleme zu haben, die Unterschiede in der Identität der «Tatort»-Marke und der «Polizeiruf 110»-Marke zu erkennen. Klar, die einzelnen Teams haben ihre Charakteristika, aber mitunter finde ich die Frage gerechtfertigt „Warum ist das nun «Polizeiruf 110» und das nun «Tatort»?“ Sie haben bereits für beide Marken mehrere Skripts geschrieben – besteht für Sie eine klarere Trennung?
Für mich hängt es im Grunde genommen von den Figuren ab, die wir erzählen. Das Label, das davor steht, ist mir dabei nicht wichtig. Ich finde, es gibt im «Polizeiruf» ebenso spannende Kommissare wie im «Tatort». Was die Kollegen in Rostock gemacht haben oder in München, finde ich zum Beispiel toll. Wie sich Fälle abspielen, hängt immer von den Ermittlerrollen ab, nicht von der Marke. Der einzige Unterschied, den es formatbezogen gibt, ist, dass es im «Polizeiruf 110» nicht immer unbedingt um Mord gehen muss – selbst wenn es letztlich häufig der Fall ist. Im «Tatort» dagegen gibt es die Vorgabe, dass es sich um Mordfälle zu drehen hat.
„
Es ist so, dass ich mit der RBB-Redaktion ständig im Kontakt stehe, und wir uns immer wieder darüber austauschen, welche Ideen wir haben und wie es weitergehen könnte
”
Christian Jeltsch
Es ist so, dass ich mit der RB-Redaktion ständig im Kontakt stehe, und wir uns immer wieder darüber austauschen, welche Ideen wir haben und wie es weitergehen könnte. Diese Idee hatte ich zwar schon im Vorfeld, aber ich wusste sofort, dass sie eigentlich ganz gut zu Bremen passt, weil ich da schon ein paar Mal Geschichten über politische oder soziale Moral geschrieben habe. Und ich weiß, dass Annette Strelow da gerne mitzieht, und diese Themen gerne erzählt, daher passte die Geschichte sehr gut in das Bremer Umfeld.
Wie gestaltet sich für Sie als «Tatort»-Autor jeweils die Zusammenarbeit mit den Regisseuren, wie viel Input geben Sie als Autor, wie viel erhalten Sie?
Das läuft sehr unterschiedlich ab. Es gibt Regisseure, mit denen ich schon vorher mehrmals zusammengearbeitet habe, wie Florian Baymeyer beim Bremen-«Tatort» oder Friedemann Fromm und Stephan Wagner. Die kenne ich ganz gut, da beginnt der Austausch schon lange vor der Produktion. Und andere Male lernt man den Regisseur erst bei der Diskussion über das Drehbuch kennen und stellt dann fest, wie gut man zusammenpasst. Und manchmal trete ich selber mit einer Idee an den Regisseur heran, so dass man sie im Team vorstellen kann und dem Sender oder der Redaktion sagt: Wir wollen das hier gemeinsam machen. Das ist natürlich die beste Version, weil man da von Anfang an weiß, was man jeweils von der Geschichte will und dass man einen gemeinsamen Konsens hat.
„
Wenn der investigative Journalismus in den Zeitungen an Raum verliert, selbst wenn glücklicherweise etwa die Panama-Papers ihn wieder etwas aufblühen lassen, dann finde ich es umso wichtiger, dass wir als Fiction-Autoren solche Themen aufgreifen und in unseren Erzählungen verarbeiten, wann immer wir in der Wirklichkeit auf sie stoßen.
”
Christian Jeltsch
Das war sicherlich eine Herausforderung. Ich glaube, dass es bei solchen Themen wichtig ist, zumindest zu versuchen, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu schreiben, die Welt sei schlecht. Ob das gelingt, müssen andere entscheiden, doch man muss sich wenigstens bemühen, die Figuren und Situationen nicht in Schwarz-und-Weiß-, sondern in Grautönen zu gestalten. Das war zumindest mein Anliegen, ob mir dies gelungen ist, werden die Zuschauer und Kritiker entscheiden. Aber ich finde, dass es von Belang ist, solche Geschichten zu erzählen, da sie aus der Realität kommen. Und wenn der investigative Journalismus in den Zeitungen an Raum verliert, selbst wenn glücklicherweise etwa die Panama-Papers ihn wieder etwas aufblühen lassen, dann finde ich es umso wichtiger, dass wir als Fiction-Autoren solche Themen aufgreifen und in unseren Erzählungen verarbeiten, wann immer wir in der Wirklichkeit auf sie stoßen.
Daher fand ich «Spotlight» so spannend. Die wahre Geschichte, die er nacherzählt, ist 15 Jahre her, und ich saß schockiert im Kino, wie sehr sich die Arbeitswelt der Journalisten seither geändert hat. Heutzutage können sich kaum noch Zeitungen ein Team leisten, das monatelang an nur einem Artikel arbeitet und dafür ein festes Gehalt bekommt …
Genau dies, die veränderte Situation des investigativen Journalismus, bewegt mich auch. Es ist so, dass ich derzeit darüber nachdenke, eine Geschichte darüber zu schreiben, wie investigative Journalisten heutzutage dastehen und arbeiten. Denn ich finde, dass man das unbedingt erzählen muss, wie schlecht sie bezahlt werden und wie gering ihre Chancen sind, um zu überleben, wenn sie sich komplexen Themen annehmen und monatelang nur dafür recherchieren. So etwas ist mittlerweile wohl nur noch im großen Verbund möglich, alleine hingegen ist das nicht mehr zu bewerkstelligen. Wer soll das finanzieren? Das Thema finde ich wahnsinnig spannend, denn es braucht einfach Leute, die hinter die Kulissen schauen und kritisch nachfragen. Dieses ausgleichende, recherchierende Moment der Presse muss gestärkt und dargestellt werden. Ob meine Idee dazu Gestalt annimmt, und ob es die Sender interessieren wird, müssen wir aber noch abwarten …
Herzlichen Dank für das Gespräch.
«Tatort: Der hundertste Affe» ist am 16. Mai 2016 ab 20.15 Uhr im Ersten zu sehen.








 NBC 16/17: Viele Adaptionen, Spin-Offs und neue Comedys
NBC 16/17: Viele Adaptionen, Spin-Offs und neue Comedys Historisches Formel-1-Rennen aus Quotensicht zweischneidige Sache
Historisches Formel-1-Rennen aus Quotensicht zweischneidige Sache

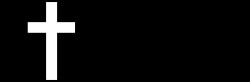








 Rechtsreferendariat im Bereich Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt Urheberrecht
Rechtsreferendariat im Bereich Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt Urheberrecht 




Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel