Die beiden Filme haben eines gemeinsam: Sie versprühen so viel Optimismus wie eine Erzählung von Franz Kafka. Damit passen sie zum typisch deutschen Fernsehfilmduktus und zu jener grundlegenden Narrative, mit denen hierzulande gerne an die Zukunft (und fast alles andere) gedacht wird. Um es mit dem Eric-Hansen-Axiom auszudrücken: Während Amerikaner vom Erfolg träumen, träumen die Deutschen vom Untergang.
Vielleicht hat auch das diese beiden Filme so unerträglich gemacht. Neben all den Verfremdungen und Verfälschungen, die über bloße Überzeichnungen weit hinausgingen, der unanständigen Verklärung von allem, was „natürlich“ ist, und der böswilligen Unterstellung, dass alle, die anderer Meinung sind als der in Deutschland populären, Übles im Schilde führen. Im Journalismus würde man eine solche Darstellung tendenziös, wenn nicht demagogisch nennen. Unter dem Gros der deutschen Fernsehkritiker gilt sie in fiktionaler Aufbereitung dagegen als große Erzählkunst.
Das Weltbild dieser Filme ist so einfach wie volkstümlich: Die da oben sind schuld an allem, und wäre es nicht schön, alles könnte so bleiben wie es ist. Ohne „Gen-Food“, ohne Wandel der Arbeitswelt, ohne Globalisierung. Die Begründungen für diese Standpunkte bleiben dabei vor allem eines: völlig diffus, zusammengebrabbelt aus allerhand Gefühlen, und nicht nur kenntnisfrei, sondern mit einem vollständigen Desinteresse an überprüfbaren Fakten. Denn die sind ja im Zweifel ohnehin manipuliert, von den Mächtigen. Viel zu viel Meinung, viel zu wenig Sachverstand.
Demnächst dann ein Film über Crispr/Cas9?






 «Mitfahr-Randale»: Kleines Entertainment-Häppchen für zwischendurch
«Mitfahr-Randale»: Kleines Entertainment-Häppchen für zwischendurch Bayern und BVB auf Knopfdruck: Das Geschäft illegaler Sport-Livestreams
Bayern und BVB auf Knopfdruck: Das Geschäft illegaler Sport-Livestreams










 Initiativbewerbungen (m/w/d)
Initiativbewerbungen (m/w/d)
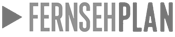
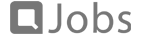


Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel