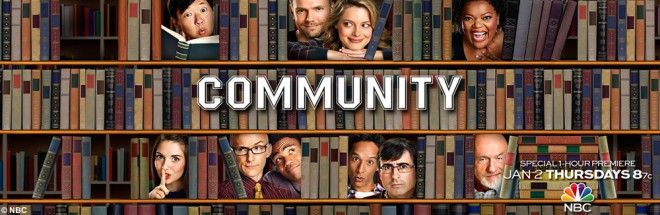
10 Erkenntnisse, für die wir «Community» alle lieben sollten
Zum Netflix-Start der Sitcom «Community» wagt unsere Redakteurin Antje Wessels - ihres Zeichens wohl größter «Community»-Fan aller Zeiten - einen ganz persönlichen Rückblick auf die Serie, der übrigens kleine Spoiler enthalten kann.
1. Tu was Dich glücklich macht!
Supersportler Troy war in seiner High School ein Mädchenschwarm und ein begnadeter Footballspieler mit Sportstipendium, das er jedoch verfallen ließ, indem er eine Verletzung vortäuschte. Auf dem Greendale College scheint seine eigentliche Bestimmung gefunden: Die im Gebäude ebenfalls ansässige Klimaanlagenfakultät (!) erkennt das vielfach veranschaulichte, tatsächlich vorhandene Talent Troys als Klempner und Klimaanlagenreparateur und unternimmt alles, um ihn abzuwerben. Als ihr das tatsächlich gelingt, zeigt er sich selbst von den hochkomplexesten Aufgaben unterfordert – Troy ist offenbar tatsächlich zum Klempner geboren, hat eine naturgegebene Gabe und könnte eine große Karriere starten. Doch eine einfache Tatsache lässt ihn diesen Schritt hinterfragen: Es macht ihn nicht glücklich! Troy sagt „Nein!“ zu einem Leben voller Bewunderung und Popularität (ja, im «Community»-Kosmos kann man auf diese Weise tatsächlich zur Berühmtheit aufsteigen!), weil ihm innere Zufriedenheit wichtiger ist. Ganz schön inspirierend!
2. Einzigartigkeit sticht Makellosigkeit!
 Es ist einer von vielen Running Gags: die ständige Betonung, wie abgefuckt das Greendale Community College eigentlich ist. Hier gibt es Kurse wie „Luftanhalten für Fortgeschrittene“, das Abendcollege ist die Erfindung eines faulen Dozenten, selbst ein Hund hat hier schon seinen Abschluss gemacht – von den Baumängeln und der mangelhaften Ausstattung einmal ganz abgesehen. Zu Beginn hat dieser Mangel an Perfektion noch Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Studenten und Lehrkräfte, bis anlässlich einer Überprüfung durch die Aufsichtsbehörde alles unternommen wird, um das College auf Vordermann zu bringen. Die Folge: Greendale ist ab sofort etwas wert – und damit bereit, verkauft zu werden. Für die Lerngruppe bricht eine Welt zusammen, ganz zu Schweigen vom Studienleiter, der sein in einem katastrophalen Zustand befindliches College über alles geliebt hat. Denn was bringt einem Perfektion, wenn man von dieser selbst gar nichts hat – außer zu wissen, dass sie existiert.
Es ist einer von vielen Running Gags: die ständige Betonung, wie abgefuckt das Greendale Community College eigentlich ist. Hier gibt es Kurse wie „Luftanhalten für Fortgeschrittene“, das Abendcollege ist die Erfindung eines faulen Dozenten, selbst ein Hund hat hier schon seinen Abschluss gemacht – von den Baumängeln und der mangelhaften Ausstattung einmal ganz abgesehen. Zu Beginn hat dieser Mangel an Perfektion noch Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Studenten und Lehrkräfte, bis anlässlich einer Überprüfung durch die Aufsichtsbehörde alles unternommen wird, um das College auf Vordermann zu bringen. Die Folge: Greendale ist ab sofort etwas wert – und damit bereit, verkauft zu werden. Für die Lerngruppe bricht eine Welt zusammen, ganz zu Schweigen vom Studienleiter, der sein in einem katastrophalen Zustand befindliches College über alles geliebt hat. Denn was bringt einem Perfektion, wenn man von dieser selbst gar nichts hat – außer zu wissen, dass sie existiert.3. Unterschätze niemals die Fiktion!
Schon Abed wusste: „Fernsehen ergibt Sinn, hat Struktur, Logik und Regeln. Und nette Leitfiguren. Im Leben haben wird das!“. Der am Asperger-Syndrom leidende «Community»-Liebling begreift die Welt mithilfe von Film- und Serienschemata, verwendet Popkulturreferenzen um das Abenteuer Leben zu verstehen. Natürlich lässt sich nicht jedes beliebige Szenario mit einem fiktiven Ereignis vergleichen, doch es kann helfen, gängige Dramaturgien auf die weitaus komplexer funktionierende Realität anzuwenden, um ihr jene Komplexität für einen Moment zu rauben und das häufig nur allzu simple Problem zu entlarven. Im Kern wiederholen sich die Schwierigkeiten in der irdischen Existenz nämlich sehr wohl, sie treten nur in wechselnder Gestalt auf.
4. Es gibt keinen Masterplan!
Die Zusammenstellung der Lerngruppe steht natürlich auf den ersten Blick für die ethnische und soziale Vielfalt, die sich am Greendale Community College die Klinke in die Hand gibt. Gleichzeitig spiegelt die Gemeinschaft aus alt, jung, verheiratet, geschieden, Junggesellen, Machos, Studienabbrechern, Müttern… aber vor allem eines wieder: die Tatsache, dass kein Lebensentwurf pauschal als „der richtige“ bezeichnet werden kann. Jeder in diesem illustren Rund aus Freunden hat in seinem Leben kleine und große Probleme, vollkommen unabhängig davon, ob er nun beliebt, ein Außenseiter, ein Charmebolzen oder ein Eigenbrötler ist. Und das Beste daran: Der Community ist das tatsächlich vollkommen egal. Über Umwege kommt jeder irgendwie voran. Welches Ziel er dabei verfolgt, ist da erst einmal zweitrangig.
5. Es existiert ein Unterschied zwischen Böses tun und böse sein!
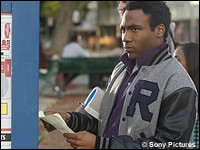 In «Community» gibt es keinen Antagonisten. Und das hat einen Grund: Die Macher der Serie unterscheiden in ihrem Format sehr gekonnt, ob eine Figur böse ist, oder ob sie gerade „nur“ etwas Böses tut. In den aller meisten Fällen kommen sie zu der Erkenntnis, dass sich kein Mensch ausschließlich einer Seite zuordnen lässt. Die Hauptfiguren leisten sich im Laufe der sechs Staffeln allesamt Fehltritte (von denen manche sogar ziemlich deutliche Auswirkungen auf das Gruppengefüge haben), können diese jedoch an anderer Stelle durch gegenteiliges Handeln kompensieren. Und selbst wenn es bei manchen länger dauert, schlechte Gewohnheiten abzulegen, lassen sie sich von ihrem Umfeld zu Besserem inspirieren. Niemand muss und sollte sich verstellen, um Andere glücklich zu machen. Doch charakterliche Veränderung in Form von Reifung ist richtig und wichtig, um auf Dauer zu einem harmonischen Miteinander beizutragen. Das hat sogar Pierce Hawthorne irgendwann begriffen.
In «Community» gibt es keinen Antagonisten. Und das hat einen Grund: Die Macher der Serie unterscheiden in ihrem Format sehr gekonnt, ob eine Figur böse ist, oder ob sie gerade „nur“ etwas Böses tut. In den aller meisten Fällen kommen sie zu der Erkenntnis, dass sich kein Mensch ausschließlich einer Seite zuordnen lässt. Die Hauptfiguren leisten sich im Laufe der sechs Staffeln allesamt Fehltritte (von denen manche sogar ziemlich deutliche Auswirkungen auf das Gruppengefüge haben), können diese jedoch an anderer Stelle durch gegenteiliges Handeln kompensieren. Und selbst wenn es bei manchen länger dauert, schlechte Gewohnheiten abzulegen, lassen sie sich von ihrem Umfeld zu Besserem inspirieren. Niemand muss und sollte sich verstellen, um Andere glücklich zu machen. Doch charakterliche Veränderung in Form von Reifung ist richtig und wichtig, um auf Dauer zu einem harmonischen Miteinander beizutragen. Das hat sogar Pierce Hawthorne irgendwann begriffen.6. Du musst nicht alles wissen, um glücklich zu sein!
In einem entscheidenden Punkt in der zweiten Staffel wird aus der Gruppe von Freunden eine jederzeit für sich und einander einstehende Gemeinschaft. In jener Folge «Die fast nackte Wahrheit» vermisst Streberin Annie einen Stift, nach dem anschließend jeder aus der Gruppe abgesucht wird. Die Szenerie endet damit, dass sich alle nackt gegenüber stehen, jeder beteuert, ihn nicht zu haben und er bis zuletzt immer noch nicht aufgetaucht ist. Es steht im Raum, wie sich die Gruppenmitglieder jemals wieder vertrauen können, wenn einer von ihnen doch offenbar ein gemeiner Stiftedieb ist. Für Jeff steht fest: Vertrauen hat nichts mit Wissen zu tun, sondern mit Glauben. Gemeinsam mit Troy erfindet er die Geschichte eines Geistes, der sich den Stift unter den Nagel gerissen hat. Auch wenn diese Story noch so unglaubwürdig ist, ist sie immer noch realistischer als die Annahme, Jemand aus der Gruppe könnte den Stift geklaut haben. Was tatsächlich passiert ist, spielt letztlich überhaupt keine Rolle mehr. (Anmerkung: Ein Affe in den Luftschächten hatte den Stift geklaut – auch nicht viel irrer, als die Idee mit dem Geist).
7. An Vergangenem festzuhalten ist okay!
 Vier Jahre (= vier Staffeln) lang bildeten die Greendale Seven eine eingeschworene Gemeinschaft. In der fünften begannen sich schließlich nach und nach Charaktere zu verabschieden, die in Teilen durch andere ersetzt wurden. Weil Letzteres in vielen Formaten oft für Missstimmung bei den Fans sorgt, machten die Drehbuchautoren aus dem vermeintlichen Problem nie einen Hehl. Angefangen bei Abed, der dieses Schema von einer Meta-Ebene aus analysierte über die auch von den anderen Figuren vielmals getätigten Versuche, die neuen Charaktere auf ein und dieselbe Stufe mit den ehemaligen zu stellen bis hin zur finalen Erkenntnis in Staffel sechs, dass die Gruppe mittlerweile zu sehr auseinander gefallen ist, um noch dieselbe Dynamik wie zu Beginn auszustrahlen, kamen die Verantwortlichen irgendwann zu dem Schluss, die Serie zu beenden, bevor sie sich selbst tot läuft. Das Bemerkenswerte: Das Schwelgen in Erinnerungen nutzten die Macher für emotional vielfältige Reaktionen: Sie erlaubten Melancholie beim Erinnern daran, dass Abed sich von seinem besten Freund verabschieden musste ebenso wie Spaß, wenn durch das Ableben des permanenten Störenfrieds Pierce Hawthorne wenigstens ein bisschen Ruhe in die Gruppe einkehren konnte. Sich an Vergangenes zu erinnern, bedeutet nicht automatisch Rückstand, sondern das Besinnen darauf, dass wir von dem geformt werden, was wir erleben.
Vier Jahre (= vier Staffeln) lang bildeten die Greendale Seven eine eingeschworene Gemeinschaft. In der fünften begannen sich schließlich nach und nach Charaktere zu verabschieden, die in Teilen durch andere ersetzt wurden. Weil Letzteres in vielen Formaten oft für Missstimmung bei den Fans sorgt, machten die Drehbuchautoren aus dem vermeintlichen Problem nie einen Hehl. Angefangen bei Abed, der dieses Schema von einer Meta-Ebene aus analysierte über die auch von den anderen Figuren vielmals getätigten Versuche, die neuen Charaktere auf ein und dieselbe Stufe mit den ehemaligen zu stellen bis hin zur finalen Erkenntnis in Staffel sechs, dass die Gruppe mittlerweile zu sehr auseinander gefallen ist, um noch dieselbe Dynamik wie zu Beginn auszustrahlen, kamen die Verantwortlichen irgendwann zu dem Schluss, die Serie zu beenden, bevor sie sich selbst tot läuft. Das Bemerkenswerte: Das Schwelgen in Erinnerungen nutzten die Macher für emotional vielfältige Reaktionen: Sie erlaubten Melancholie beim Erinnern daran, dass Abed sich von seinem besten Freund verabschieden musste ebenso wie Spaß, wenn durch das Ableben des permanenten Störenfrieds Pierce Hawthorne wenigstens ein bisschen Ruhe in die Gruppe einkehren konnte. Sich an Vergangenes zu erinnern, bedeutet nicht automatisch Rückstand, sondern das Besinnen darauf, dass wir von dem geformt werden, was wir erleben.8. Wenn du dich selbst kennst ist es nicht schlimm, sich anzupassen!
Wenn wir jung sind, denken wir, wir müssen uns anpassen, um von Anderen akzeptiert zu werden. Irgendwann merken wir, dass Persönlichkeit viel entscheidender ist als Mitläufertum. Dabei ist es eigentlich eine Mischform aus beiden Extremen, mit der wir zufrieden durchs Leben gehen können. Schließlich lassen sich nicht alle unsere Charaktereigenschaften zu jedem Zeitpunkt passend ausleben. Auch eine Dramaqueen muss in manchen Momenten einfach einen Gang zurück schalten. Genauso wie besonders schüchterne Zeitgenossen hier und da über ihren Schatten springen müssen, um nicht den Anschluss an die Welt zu verlieren. Das funktioniert jedoch nicht einfach, indem man sich eine Maske aufsetzt, unter der man vergisst, man selbst zu sein. Stattdessen ist die Besinnung auf das, was uns ausmacht, am wichtigsten – dann können wir in manchen Momenten so sein, wie es für unser Umfeld gerade angebracht ist und bleiben doch wir selbst.
9. Hinterfrage Vorurteile, bevor du sie selbst verurteilst!
 Vorurteile oder Klischees zu bemühen, ist nie die intelligenteste Form, sich mit einer Sache auseinander zu setzen. Doch in der Regel ist Jemandem nicht damit geholfen, wenn er einfach nur von Jetzt auf Gleich damit aufhört. Pierce Hawthorne, eine der sieben Hauptfiguren in «Community», ist zu Beginn der Serie ein schwulen- und frauenfeindlicher Rassist, der von seinen Freunden immer wieder zurecht gewiesen wird, doch endlich seinen Horizont zu erweitern. Tatsächlich zu ihm durchdringen können sie allerdings erst ab Staffel drei, als sie mit seinem (noch weitaus radikaler denkenden) Vater erkennen, wo das fragwürdige Verhalten ihres Mitstudenten herrührt. Es hilft also nicht zwingend, einfach nur die Symptome falschen Verhaltens zu behandeln. Stattdessen ist es dauerhaft viel besser, zu ergründen, wo es herkommt und zu Beginn der Aufklärung vielleicht sogar zu versuchen, Verständnis für die jeweilige Ursache aufzubringen. Man muss erst zur Quelle gelangen, um den Ursprung allen Übels auch genau dort zu ersticken.
Vorurteile oder Klischees zu bemühen, ist nie die intelligenteste Form, sich mit einer Sache auseinander zu setzen. Doch in der Regel ist Jemandem nicht damit geholfen, wenn er einfach nur von Jetzt auf Gleich damit aufhört. Pierce Hawthorne, eine der sieben Hauptfiguren in «Community», ist zu Beginn der Serie ein schwulen- und frauenfeindlicher Rassist, der von seinen Freunden immer wieder zurecht gewiesen wird, doch endlich seinen Horizont zu erweitern. Tatsächlich zu ihm durchdringen können sie allerdings erst ab Staffel drei, als sie mit seinem (noch weitaus radikaler denkenden) Vater erkennen, wo das fragwürdige Verhalten ihres Mitstudenten herrührt. Es hilft also nicht zwingend, einfach nur die Symptome falschen Verhaltens zu behandeln. Stattdessen ist es dauerhaft viel besser, zu ergründen, wo es herkommt und zu Beginn der Aufklärung vielleicht sogar zu versuchen, Verständnis für die jeweilige Ursache aufzubringen. Man muss erst zur Quelle gelangen, um den Ursprung allen Übels auch genau dort zu ersticken.10. Bonus: Es gibt verschiedene Zeitstränge!
Und weil das so ist, bist du in einem von ihnen immer glücklich, genauso wie du in einem von ihnen immer unglücklich sein wirst. Es ist also Zeit, sich zu entspannen!
05.04.2020 10:00 Uhr
• Antje Wessels
Kurz-URL: qmde.de/117156
