«3 Tage in Quiberon»
Ehrenpreise bei der Lola 2018
Der Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor Hark Bohm wird mit dem Ehrenpreis für herausragende Verdienste um den Deutschen Film ausgezeichnet. Darüber hinaus geht der undotierte Preis für den besucherstärksten deutschen Film des Jahres erwartungsgemäß an Bora Dagtekin, den Autor und Regisseur von «Fack Ju Göhte 3».Die optisch Romy Schneider durchaus nahe kommende Marie Bäumer («Irre sind männlich») spielt in ihrer Performance gleichermaßen mit ihrem Image als trauriges Mädchen und glamouröse Lady; ganz so, als wäre die Figur der Romy Schneider ihr in Fleisch und Blut übergegangen. In Mimik und Gestik kommt sie ganz nah an ihr Vorbild heran und hält den Zuschauer durch ambivalente Aussagen und ihre verhuschte Attitüde immer auch auf Abstand – an Schneider kam man schon zu Lebzeiten nicht heran; in «3 Tage in Quiberon» ebenfalls nicht.
Wie auch schon die Anfang der Achtzigerjahre in Quiberon aufgenommenen Fotografien von Romy Schneider, drehte Emily Atef ihr Drama in elegantem Schwarz-Weiß. Im Fokus stehen neben der Schauspielerin der Journalist Michael Jürgs, Schneiders enger Vertrauter und Fotograf Robert Lebeck und ihre beste Freundin Hilde, die als einzige Figur in «3 Tage in Quiberon» fiktiven Ursprungs ist. Dieses Vier-Personen-Stück findet in der kammerspielartigen Kulisse des Fünf-Sterne-Hotels an der bretonischen Küste ihr perfektes Setting, um die Interaktion zwischen Schneider und Jürgs nach und nach zum Brodeln zu bringen. Auf der einen Seite steht der Journalist, der – wie die eigentlich von ihm verachtete Boulevardpresse – vorwiegend provokant auftritt, um mit seinen reißerischen Fragen möglichst noch reißerische Antworten zu ergattern. Auf der anderen Seite steht Romy Schneider, ein wenig zu naiv für ihren Status als Weltstar, die lediglich von ihrer besten Freundin unterstützt wird. Während die Freundschaft zwischen den beiden Frauen zunächst wie das einzig Echte an diesem Szenario erscheint, dauert es nicht lang, bis der Reporter genügend Zweifel daran geschürt hat, dass es auch nur einen Menschen gibt, der Romy Schneider nicht als Filmstar, sondern als Menschen ansieht.
Zur restlichen Kritik
«Der Hauptmann»
Nominiert für Film, Nebendarsteller (Alexander Fehling), Ton, Schnitt, Musik
 Regisseur und Autor Schwentke skizziert Schritt für Schritt, wie der Gefreite Willi Herold von einem Wegläufer zu einer herumalbernden Hauptmann-Karikatur und letztlich von einem die Bürokratie in einem Gefangenenlager auf den Kopf stellenden Störenfried zu einer Tötungsmaschine wird. So sehr diese Übergänge durch die gezielt-qualvolle Genauigkeit, mit der Schwentke Wendepunkte ausspielt, und das getragen-intensive Spiel des Hauptdarstellers Max Hubacher glaubwürdig ausfallen, bleiben klaffende Fragen offen: «Der Hauptmann» zeigt die Abläufe in dokumentarischer Genauigkeit, eingefangen in niederschmetternd-eiskalten Schwarz-Weiß-Bildern – doch der psychologisch-erklärende Kommentar bleibt durchweg aus.
Regisseur und Autor Schwentke skizziert Schritt für Schritt, wie der Gefreite Willi Herold von einem Wegläufer zu einer herumalbernden Hauptmann-Karikatur und letztlich von einem die Bürokratie in einem Gefangenenlager auf den Kopf stellenden Störenfried zu einer Tötungsmaschine wird. So sehr diese Übergänge durch die gezielt-qualvolle Genauigkeit, mit der Schwentke Wendepunkte ausspielt, und das getragen-intensive Spiel des Hauptdarstellers Max Hubacher glaubwürdig ausfallen, bleiben klaffende Fragen offen: «Der Hauptmann» zeigt die Abläufe in dokumentarischer Genauigkeit, eingefangen in niederschmetternd-eiskalten Schwarz-Weiß-Bildern – doch der psychologisch-erklärende Kommentar bleibt durchweg aus. Das gehört zu den schmerzhaft konsequenten Aspekten dieses Films. «Der Hauptmann» lässt Herolds Vorgeschichte im Unklaren, übt sich generell nicht in Küchenpsychologie und argumentiert, dass dieses und jenes ja nur so weit gekommen sei weil bla und laberlaber. Schonungslos und direkt setzt uns dieses brutale Drama dem aus, was passiert ist – ohne relativierende, womöglich gar beschwichtigende Erklärungen. Einige der Mechanismen, die diese realen Ereignisse begünstigten, sind offensichtlich – aber Schwentke überlässt es ganz seinem bestürzten Publikum, diese Brotkrumen aufzusammeln. Das Publikum an die Hand zu nehmen, würde ja die Schrecken mildern, die es erläutert haben möchte.
Ebenso beschönigt Florian Ballhaus' Kameraarbeit die stetig eskalierende Ereignisabfolge um keinen einzigen Deut. Obwohl Schwentke nach eigenen Aussagen den Film in Schwarz-Weiß drehte, weil die gewissenlosen Geschehnisse sonst nicht zu ertragen wären, kommt das Monochrome dieses Films auch einem Schlag in die Magengrube gleich. Wäre «Der Hauptmann» ein Farbfilm, wäre er zwar sehr blutig, jedoch ermögliche sich in den härteren Sequenzen somit, je nach persönlicher Einstellung gegenüber Filmgewalt, eine Flucht darin, den erreichten Realismus der Blut- und Schusseffekte zu bestaunen. Das blanke Schwarz-Weiß der weiten Kameraeinstellungen, die Ballhaus hier wählt, verbietet solch eine Flucht, so dass die Ästhetik des Films genauso trostlos ausfällt wie die Seelen seiner zentralen Figuren.
Zur restlichen Kritik
«Aus dem Nichts»
Nominiert für Film, Regie, Drehbuch, Hauptdarstellerin (Diane Kruger), Kamera
 Wenn Diane Kruger («Inglourious Basterds») – die in «Aus dem Nichts» zweifellos die mit Abstand beste Leistung ihrer bisherigen Karriere abliefert und in Cannes dafür völlig zu Recht mit der Goldenen Palme als „Beste Schauspielerin“ ausgezeichnet wurde – im nächsten Moment aufspringt, um den Peinigern ihrer Familie an die Gurgel zu gehen, möchte man die junge Frau nicht zurückhalten (nicht einmal das hohe Gericht sieht es ihr in diesem Moment nach – ein Funken Hoffnung in einem vielleicht mitunter zu emotionslos geführten Rechtssystem). Der auch für das Skript zuständige Fatih Akin geht in seinem Film nicht umsonst einen Weg über drei verschiedene Genres, beginnt beim markerschütternden Familiendrama, nimmt den Abstecher über den Gerichtsfilm und mündet in einen Rachewestern von beneidenswerter Konsequenz. Um die Frage nach der Vertretbarkeit von Rache und Selbstjustiz geht es dem gebürtigen Deutschen mit türkischen Wurzeln allerdings überhaupt nicht; und an dieser Stelle geht Akin dann auch den einzig richtigen Weg im Kampf gegen sinnlose Gewalt. Er verzichtet auf sein Urteil. Stattdessen bleibt er auch im letzten Drittel konsequent auf Augenhöhe mit seiner Protagonistin und lässt uns damit nicht bloß an ihrem Schmerz teilhaben, sondern führt uns auch ihren Wandel vor Augen, als aus der – im wahrsten Sinne des Wortes – am Boden liegenden Witwe eine abgeklärte Bombenbauerin wird.
Wenn Diane Kruger («Inglourious Basterds») – die in «Aus dem Nichts» zweifellos die mit Abstand beste Leistung ihrer bisherigen Karriere abliefert und in Cannes dafür völlig zu Recht mit der Goldenen Palme als „Beste Schauspielerin“ ausgezeichnet wurde – im nächsten Moment aufspringt, um den Peinigern ihrer Familie an die Gurgel zu gehen, möchte man die junge Frau nicht zurückhalten (nicht einmal das hohe Gericht sieht es ihr in diesem Moment nach – ein Funken Hoffnung in einem vielleicht mitunter zu emotionslos geführten Rechtssystem). Der auch für das Skript zuständige Fatih Akin geht in seinem Film nicht umsonst einen Weg über drei verschiedene Genres, beginnt beim markerschütternden Familiendrama, nimmt den Abstecher über den Gerichtsfilm und mündet in einen Rachewestern von beneidenswerter Konsequenz. Um die Frage nach der Vertretbarkeit von Rache und Selbstjustiz geht es dem gebürtigen Deutschen mit türkischen Wurzeln allerdings überhaupt nicht; und an dieser Stelle geht Akin dann auch den einzig richtigen Weg im Kampf gegen sinnlose Gewalt. Er verzichtet auf sein Urteil. Stattdessen bleibt er auch im letzten Drittel konsequent auf Augenhöhe mit seiner Protagonistin und lässt uns damit nicht bloß an ihrem Schmerz teilhaben, sondern führt uns auch ihren Wandel vor Augen, als aus der – im wahrsten Sinne des Wortes – am Boden liegenden Witwe eine abgeklärte Bombenbauerin wird. Die moralischen Zweifel lässt Akin dabei nie außer Acht; diese Katja ist nicht bloß von Rachegelüsten getrieben. In ihr schlummert neben dem Verlangen nach Vergeltung auch der Wunsch nach einem Abschluss, symbolisch unterfüttert von unfertigen Tattoos und Menstruationsblut. Doch was tun, wenn Rache das Einzige ist, wodurch ein Opfer endlich Frieden findet? für Akin kein Tabu, sondern eine, gerade in diesem Zusammenhang, absolut naheliegende Fragestellung, die wiederum er sich sogar traut, zu beantworten.
Zur restlichen Kritik
«Das schweigende Klassenzimmer»
Nominiert für Film, Drehbuch, Kamera, Kostüm
 1956: Bei einem Kinobesuch in Westberlin sehen die Abiturienten Theo (Leonard Scheicher) und Kurt (Tom Gramenz) in der Wochenschau dramatische Bilder vom Aufstand der Ungarn in Budapest. Zurück in Stalinstadt entsteht spontan die Idee im Unterricht eine solidarische Schweigeminute für die Opfer des Aufstands abzuhalten. Doch die Geste zieht viel weitere Kreise als erwartet: Während ihr Rektor (Florian Lukas) zwar zunächst versucht, das Ganze als Jugendlaune abzutun, geraten die Schüler in die politischen Mühlen der noch jungen DDR. Der Volksbildungsminister (Burghart Klaußner) verurteilt die Aktion als eindeutig konterrevolutionären Akt und verlangt von den Schülern innerhalb einer Woche den Rädelsführer zu benennen. Doch die Schüler halten zusammen und werden damit vor eine Entscheidung gestellt, die ihr Leben für immer verändert…
1956: Bei einem Kinobesuch in Westberlin sehen die Abiturienten Theo (Leonard Scheicher) und Kurt (Tom Gramenz) in der Wochenschau dramatische Bilder vom Aufstand der Ungarn in Budapest. Zurück in Stalinstadt entsteht spontan die Idee im Unterricht eine solidarische Schweigeminute für die Opfer des Aufstands abzuhalten. Doch die Geste zieht viel weitere Kreise als erwartet: Während ihr Rektor (Florian Lukas) zwar zunächst versucht, das Ganze als Jugendlaune abzutun, geraten die Schüler in die politischen Mühlen der noch jungen DDR. Der Volksbildungsminister (Burghart Klaußner) verurteilt die Aktion als eindeutig konterrevolutionären Akt und verlangt von den Schülern innerhalb einer Woche den Rädelsführer zu benennen. Doch die Schüler halten zusammen und werden damit vor eine Entscheidung gestellt, die ihr Leben für immer verändert…Wie schon in «Der Staat gegen Fritz Bauer» blickt Lars Kraume, der auch das auf dem Buch basierende Skript verfasste, nicht einfältig auf das Geschehen. Ganz eindeutig positioniert er sich an der Seite seiner politisch engagierten Schüler, doch zu der verhängnisvollen Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des Aufstandes von Ungarn gehören deutlich komplexere Gedankengänge. Das ist für den Zuschauer nicht immer bequem; wenn Kraume im späteren Verlauf der Geschichte auch die Sichtweisen der um Aufbereitung der eigenen Erlebnisse bemühten Väter und Mütter der des Verrats beschuldigten Kinder miteinbezieht, sind die (auch emotionalen) Dimensionen der Geschichte nur zu erahnen. Insofern ist «Das schweigende Klassenzimmer» zwar fast schon als Kampf zwischen Gut und Böse zu verstehen (gerade wenn man die Performance des einmal mehr großartig unangenehmen Burkhart Klaußner als Volksbildungsminister Lange betrachtet, erhält das Böse sogar ein Gesicht), doch Kraume bemüht sich – mehr noch als das Buch – um die Ergründung noch so erschütternder Ideologien, ohne je in falsche Solidarität oder gar Verklärung abzudriften. Vielmehr geht es in «Das schweigende Klassenzimmer» darum, die hier aufbereiteten Ereignisse als Spitze eines politischen Eisbergs zu begreifen und darum, zu ergründen, wie ebenjener überhaupt entstehen konnte.
Zur restlichen Kritik
«Amelie rennt»
Nominiert als bester Kinderfilm
 Die Handlung wird in Gang gesetzt, als die 13-jährige Amelie (Mia Kasalo) mit ihren Freundinnen rumblödelt, als sie gerade ganz ohne elterliche Aufsicht sind. Dabei entfachen sie aus Versehen einen Brand. Als der Qualm in Amelies Lunge gelangt, erleidet die Asthmakranke einen schweren Anfall. Nach einem längeren Klinikaufenthalt ihrer Tochter, beschließen die in Trennung lebenden, sich trotzdem gut verstehenden Eltern Amelies (Susanne Bormann und Denis Moschitto), sie in eine Südtiroler Spezialklinik zu schicken. Dort hat die energiereiche Kratzbürste Amelie allerdings Probleme, sich einzuleben. Ihre Zimmernachbarin ist eine Klette, die Leiterin (Jasmin Tabatabai) viel zu streng, und der einzige nette Betreuer (Jerry Hoffmann) kommt nicht vollauf ehrlich rüber.
Die Handlung wird in Gang gesetzt, als die 13-jährige Amelie (Mia Kasalo) mit ihren Freundinnen rumblödelt, als sie gerade ganz ohne elterliche Aufsicht sind. Dabei entfachen sie aus Versehen einen Brand. Als der Qualm in Amelies Lunge gelangt, erleidet die Asthmakranke einen schweren Anfall. Nach einem längeren Klinikaufenthalt ihrer Tochter, beschließen die in Trennung lebenden, sich trotzdem gut verstehenden Eltern Amelies (Susanne Bormann und Denis Moschitto), sie in eine Südtiroler Spezialklinik zu schicken. Dort hat die energiereiche Kratzbürste Amelie allerdings Probleme, sich einzuleben. Ihre Zimmernachbarin ist eine Klette, die Leiterin (Jasmin Tabatabai) viel zu streng, und der einzige nette Betreuer (Jerry Hoffmann) kommt nicht vollauf ehrlich rüber.Aus dieser Ausgangslage hätten unzählige Andere eine Abwandlung der üblichen Sommercamp- und Internatsgeschichten gemacht. Amelie lernt in der Spezialklinik, wie man sich neue Freunde macht, sieht ein, dass sie ihre Atemübungen machen muss, und vielleicht bekommt die gestrenge Leiterin einen Denkzettel verpasst. Solch eine Geschichte könnte Brunckhorst, Böhrnsen und Wiemann allerdings nicht weniger reizen. Sie lassen ihre Protagonistin ausbüxen und den Bauerssohn Bart (Samuel Girardi) kennenlernen. Der erzählt seiner vorlauten und gewitzten neuen Bekannten, dass auf einem der Südtiroler Gipfel bald eine lokale Tradition abgehalten wird, bei der man über ein Feuer springt und sich etwas wünschen kann. Aller Vernunft zum Trotz will die Asthmakranke die lange Wanderung auf sich nehmen, um ihre Krankheit hinfort zu wünschen – und widerwillig schließt sich Bart ihr an. Irgendwer muss auf die irre Berlinerin ja aufpassen …
Kasalo brilliert in der vielschichtigen Rolle einer vollauf sympathischen, dennoch zu ihrem eigenen Unwohl bissigen Teenagerin, die aus dem Geschimpfe nicht heraus kommt, aber selber weiß, dass das nicht gut ankommt. Ihr Wandervorhaben ist zu gleichen Teilen Trotz gegenüber den strengen Erwachsenen, der Versuch einer unkonventionellen Asthmatherapie und Abenteuersehnsucht. Kasalo bringt dies mit Mimik und Gestik rüber und erspart dem Film somit zähe, gestelzte Expositionsmonologe. Konsequenterweise ist dieses etwas andere Roadmovie tonal abwechslungsreich, reihen sich doch sanfthumorige Eskapaden mit Ferien-Abenteuerstimmung und stillen Szenen ab, in der sich die Titelheldin sowie ihre Eltern in kritischer Selbstbetrachtung üben.
Zur restlichen Kritik



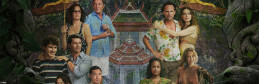




 #GNTM freut sich über treue Fanbase, leidet aber unter kälteren Temperaturen
#GNTM freut sich über treue Fanbase, leidet aber unter kälteren Temperaturen Disney kündigt neue «Star Wars»-Trickserie an
Disney kündigt neue «Star Wars»-Trickserie an











 Junior- Redakteur (m/w/d) im Bereich Reality
Junior- Redakteur (m/w/d) im Bereich Reality




Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel