«Das Institut» (von Julian Miller)
In Kallalabad, der Hauptstadt des zentralasiatischen Kisbekistan, fehlt es an vielem: nicht jedoch an deutscher Sprache und Kultur. Die zu vermitteln, ist Aufgabe des örtlichen Goethe-Instituts, dessen Handvoll Mitarbeiter trotz ausbleibender Wertschätzung der Zentrale in der Heimat (wo man davon ausgeht, den Standort schon lange geschlossen zu haben) und der Analphabeten vom Auswärtigen Amt den Betrieb irgendwie am Laufen hält. Goethe und Grönemeyer, Bernhard und Benn am Hindukusch vermitteln – dort, wo Deutschland verteidigt wird, mit den üblichen Risiken: Mal wird das Gebäude von Terroristen gekapert, deren Anführer aus militärstrategischen Gründen Deutsch lernen wollen. Mal muss verhindert werden, dass die Praktikantin einen negativen Bericht an den Hauptsitz schickt, damit die Außenstelle Kallalabad nicht doch noch dichtgemacht wird. Mal muss reichlich Penicillin verteilt werden, damit überhaupt ein paar Kisbeken zum überschaubar üppigen Fest am deutschen Nationalfeiertag kommen.
Damit hält «Das Institut» freilich eher dem deutschen Büroalltag den Spiegel vor – und einem gewissen Spannungsfeld aus kulturchauvinistischem Missionierungsdrang und empathischer Entwicklungshilfe, zwei Ansätzen, die von verschiedenen Charakteren des überschaubaren und dafür umso feiner gezeichneten Figurenorchesters verkörpert werden. Die große komödiantische Treffsicherheit von Drehbuch und Darstellerensemble machten aus diesem Stoff vermutlich die witzigste deutsche Serie der letzten Jahre.
«Pastewka» (von Timo Nöthling)
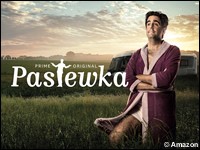 «Pastewka» wurde nicht erst in der TV-Saison 2017/2018 zum Highlight, sondern schon lange davor. Doch mit der Zeit hat diese so charmante deutsche Antwort auf «Curb Your Enthusiasm» ihren Pfiff verloren – und dann kam diese Oase in der noch recht kargen deutschen Serienlandschaft auch noch zu einem unrühmlichen Ende bei Sat.1. Der Wechsel zu Amazon und die daraus resultierende, hervorragende achte Staffel machen vor, welche neuen Modelle es gibt, um in Deutschland doch bald zu mehr sehenswerter Serien-Ware zu gelangen.
«Pastewka» wurde nicht erst in der TV-Saison 2017/2018 zum Highlight, sondern schon lange davor. Doch mit der Zeit hat diese so charmante deutsche Antwort auf «Curb Your Enthusiasm» ihren Pfiff verloren – und dann kam diese Oase in der noch recht kargen deutschen Serienlandschaft auch noch zu einem unrühmlichen Ende bei Sat.1. Der Wechsel zu Amazon und die daraus resultierende, hervorragende achte Staffel machen vor, welche neuen Modelle es gibt, um in Deutschland doch bald zu mehr sehenswerter Serien-Ware zu gelangen.Auf Skepsis und Enttäuschung nach der ersten der neuen Folgen, weil die Serie plötzlich doch deutlich anders daherkam als davor, folgte die Erkenntnis: «Pastewka» hat sich in Staffel acht erfolgreich neu erfunden und die Fesseln des linearen Fernsehens, die das Format zuletzt immer weiter eingeschränkt hatten, endlich gesprengt. Der Wechsel zur horizontalen Erzählweise kennzeichnete einen tiefen Einschnitt, doch er glückte und verschaffte der Comedy-Serie wirklichen emotionalen Tiefgang. So geht Serie – und so geht sie bald hoffentlich öfter in Deutschland.
«Babylon Berlin» (von Sidney Schering)
 Die Fernsehsaison 2017/18 hatte diverse Höhepunkte zu bieten. Die nicht ausreichend gewürdigte Comedyshow «Ponyhof» hat sich konzeptuell neu aufgestellt und dabei nichts von ihrem Witz verloren. «Pastewka» ist zurück, und manchen Fanbeschwerden zum Trotz ein Paradebeispiel dafür, wie man eine pausierte Serie zurückholt. Und wie könnte ich «Pietro Lombardi – Das Musical» übergehen? Dies ist nur eine Handvoll an Beispielen, doch ein Format hat es sich allein schon durch seinen schieren Exzess verdient, hier ausführlicher als Glanzlicht der TV-Saison vorgestellt zu werden. Und dann kommt erschwerend noch seine Aktualität hinzu. Die Rede ist von «Babylon Berlin».
Die Fernsehsaison 2017/18 hatte diverse Höhepunkte zu bieten. Die nicht ausreichend gewürdigte Comedyshow «Ponyhof» hat sich konzeptuell neu aufgestellt und dabei nichts von ihrem Witz verloren. «Pastewka» ist zurück, und manchen Fanbeschwerden zum Trotz ein Paradebeispiel dafür, wie man eine pausierte Serie zurückholt. Und wie könnte ich «Pietro Lombardi – Das Musical» übergehen? Dies ist nur eine Handvoll an Beispielen, doch ein Format hat es sich allein schon durch seinen schieren Exzess verdient, hier ausführlicher als Glanzlicht der TV-Saison vorgestellt zu werden. Und dann kommt erschwerend noch seine Aktualität hinzu. Die Rede ist von «Babylon Berlin».Die Historienserie ist eine wahre Mammutproduktion, und man sieht ihr in jeder Minute das Budget von über 40 Millionen Euro an. «Babylon Berlin» hebt deutsches Fernsehen endlich auf das Produktionsniveau solcher Hochglanzserien wie «Game of Thrones», hat dabei aber durch und durch eine eigene Identität. Diese wird ihr durch das schillernde Berlin des Jahres 1929 verliehen, das nicht nur Setting, sondern auch Thema der Serie ist. Magisch, kosmopolitisch und von (fast) aller Welt begeistert beäugt, doch hinter der hippen Fassade brodeln ideologische Feindschaften, Ressentiments und Sturheit zu einer gefährlichen Suppe des Unverständnis und der Wut hoch.
«Babylon Berlin» könnte eine Serie über das Heute sein, nur mit anderen Frisuren, Kleidern und Liedern. "Zu Asche, zu Staub", haucht es im eingängigen Titelsong. Der Serie wird es so schnell nicht so ergehen, aber wir können hoffen, dass die Parallelen zwischen Serienhandlung und tagesaktuellen Tendenzen bald zu Asche und Staub zerfallen, denn den Schienen, die in «Babylon Berlin» für die Zukunft gelegt wurden, will kein Mensch mit Herz und Verstand folgen. Nur auf der heimischen Flimmerkiste, in fiktionaler Form – dafür lässt sich gern eine Ausnahme machen.










 Die Kritiker: «Oma ist verknallt»
Die Kritiker: «Oma ist verknallt» Direkt nach der WM: «Hotel Transsilvanien 3» bekommt Sonderstart
Direkt nach der WM: «Hotel Transsilvanien 3» bekommt Sonderstart









 Producer (m/w/d) im Bereich Postproduktion
Producer (m/w/d) im Bereich Postproduktion Set-Runner/ Produktionsfahrer (w/m/d) Reality
Set-Runner/ Produktionsfahrer (w/m/d) Reality




Es gibt 2 Kommentare zum Artikel
31.05.2018 14:30 Uhr 1
31.05.2018 14:59 Uhr 2
Es soll ganz hilfreich sein, sich mehr als 2 Folgen anzugucken. Ich bin nach 2 Folgen Game of Thrones oder Breaking Bad auch nicht aus den Latschen gefallen.