 Les Films d’ici, LeBob.Fr und les Films du poisson rouge haben für arte eine Doku-Reihe fertiggestellt, die derzeit ihren Höhepunkt nicht im klassischen Fernsehen hat, sondern bei der Videoplattform YouTube. Die Google-Tochter hat eine Playlist von zehn Titeln, die zwischen neun und elf Minuten dauern und die sich mit der Welt der Mathematik beschäftigt. «Mathewelten», eine Doku-Reihe von Denis van Waerebeke, der bereits «Dates That Made History» («Quand l'histoire fait dates») umsetzte, erfreut sich seit Oktober 2021 großer Beliebtheit. Im Deutschen ist Cédric Cavatore als Sprecher zu hören, der deutsch-französische Schauspieler vertonte schon weit über 100 Dokus, Reportagen und Beiträge für arte, das ZDF und Netflix. Außerdem kennt man seine Stimme aus Werbungen wie für die Automarke KIA.
Les Films d’ici, LeBob.Fr und les Films du poisson rouge haben für arte eine Doku-Reihe fertiggestellt, die derzeit ihren Höhepunkt nicht im klassischen Fernsehen hat, sondern bei der Videoplattform YouTube. Die Google-Tochter hat eine Playlist von zehn Titeln, die zwischen neun und elf Minuten dauern und die sich mit der Welt der Mathematik beschäftigt. «Mathewelten», eine Doku-Reihe von Denis van Waerebeke, der bereits «Dates That Made History» («Quand l'histoire fait dates») umsetzte, erfreut sich seit Oktober 2021 großer Beliebtheit. Im Deutschen ist Cédric Cavatore als Sprecher zu hören, der deutsch-französische Schauspieler vertonte schon weit über 100 Dokus, Reportagen und Beiträge für arte, das ZDF und Netflix. Außerdem kennt man seine Stimme aus Werbungen wie für die Automarke KIA.Wie man es von arte kennt, beispielsweise bei der Kultursendung «Karambolage», in der auf deutsch-französische Unterschiede haargenau hingewiesen wird, kratzt auch die junge Doku-Reihe nicht nur an der Oberfläche. Die Zuschauer werden auf eine Reise in ein Land der Mathematik mitgenommen. Die Episoden spielen zwischen dem Gebirge der Algebraischen Geometrie, dem Dschungel der Wahrscheinlichkeit und dem Ozean der großen Wahrheiten. Cavatore redet von Themen wie Mannigfaltigkeiten oder transfinite Zahlen.
Aber der Reihe nach: Die erste Episode beschäftigt sich mit der „Frage des Maßstabes“ und weist die Zuschauer darauf hin, dass sie selbst ein Experiment durchführen könnten. Kauft man in einem Supermarkt 100 zufällige Produkte ein, kosten die meisten Produkte zwischen 1,00 und 1,99 Euro. Die Zahlen vor dem Komma sind entscheidend – das ist allerdings kein Zufall. Und vor allem ist das kein System, das nur uns Europäer betrifft: Ob das türkische Lira, amerikanische Dollar oder russische Rubel sind, die Verteilung der Zahlen ist immer gleich. Scheint das Phänomen so zu sein, dass Supermärkte kleine Ziffern bevorzugen?
 Ist die Antwort so simpel? Für ein weiteres Beispiel begibt sich «Mathewelten» auf das Überseegebiet Französisch-Polynesien, das im südlichen Pazifik liegt. Schaut man sich die Flächen der einzelnen Inseln an, so wird auch hier klar: Die Verteilung der Inselgrößen ist mit den Supermärkten identisch. Die Produzenten haben sich mit der Materie auseinandergesetzt und verraten: Nimmt man beispielsweise den Umsatz großer Unternehmen zum Vergleich oder schaut man sich die Größe verschiedener Städte an, findet sich auf der Welt immer die gleiche Verteilung.
Ist die Antwort so simpel? Für ein weiteres Beispiel begibt sich «Mathewelten» auf das Überseegebiet Französisch-Polynesien, das im südlichen Pazifik liegt. Schaut man sich die Flächen der einzelnen Inseln an, so wird auch hier klar: Die Verteilung der Inselgrößen ist mit den Supermärkten identisch. Die Produzenten haben sich mit der Materie auseinandergesetzt und verraten: Nimmt man beispielsweise den Umsatz großer Unternehmen zum Vergleich oder schaut man sich die Größe verschiedener Städte an, findet sich auf der Welt immer die gleiche Verteilung.Hinter diesem Mysterium steckt der im Mai 1883 in Johnstown, Pennsylvania, USA, geborene Frank Benford, der nach seinem Studium an der University of Michigan, fast 30 Jahre beim Mischwarenkonzern General Electric als Ingenieur und Physiker angestellt war. Dort war er für die optische Messung und andere Themen zuständig, sodass er dort sein Benfordsches Gesetz entwickeln konnte. Dieses beschreibt eine Gesetzmäßigkeit in der Verteilung der führenden Ziffern von ganzen Zahlen in empirischen Datensätzen.
Die Ursprünge dieser Gesetzmäßigkeit entdeckte bereits 1881 Simon Newcomb, da er bemerkte, dass die Logarithmentafeln von Seiten mit Tabelle mit Eins abgenutzter wirkten. Doch für diese Entdecktung geriet er in Vergessenheit, erst Benford konnte die Entdeckung mit einer entsprechenden wissenschaftlichen Größe publizieren. Übrigens: «Mathewelten» erklärt nicht nur, wie es zu dieser Entdeckung kam, sondern warum solche wissenschaftlichen Dinge möglich sind. Es kommt auch auf den Blickwinkel an: Während sich der Preis von einem auf zwei Euro verdoppelt, springt der Preis von neun auf zehn Euro nur um knapp elf Prozent. Das Feld, in dem sich die Preise streuen, ist eindeutig größer.
Nicht nur Themen wie das Beldfordsche Gesetz sind Teil der arte-Serie «Mathewelten», auch Dinge wie die Pointcaré-Vermutung, der Gödelsche Unvollständigkeitssatz und Unendlichkeit sind Teile der Reihe.
«Mathewelten» ist ohne Werbung in deutscher Sprache bei YouTube verfügbar.







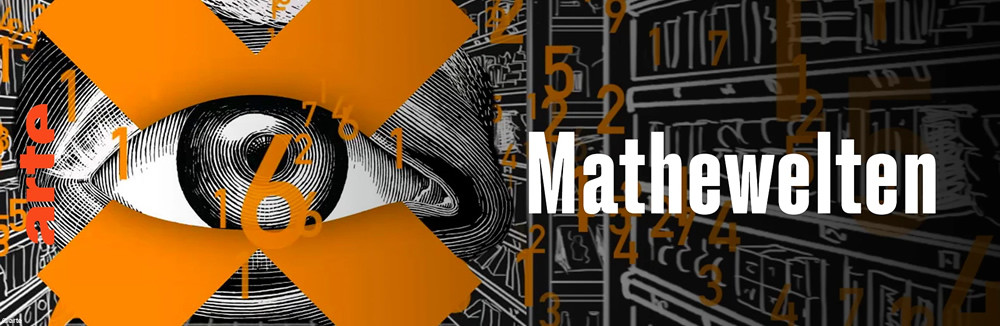


 Ist Yvonnes Krebs zurück?
Ist Yvonnes Krebs zurück? Super RTL zeigt neue Pokémon-Serie
Super RTL zeigt neue Pokémon-Serie








 Chief of Staff / Business & Strategy Manager (m/w/d)
Chief of Staff / Business & Strategy Manager (m/w/d) Light Operator / Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m/w/d) – Schwerpunkt Licht
Light Operator / Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m/w/d) – Schwerpunkt Licht Initiativbewerbungen (m/w/d)
Initiativbewerbungen (m/w/d)




Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel