Ich komme vom Thema Bildungsgerechtigkeit. Schon aus beruflicher (Dokus zum Thema) und aus persönlicher Erfahrung: Die „Castings“ unserer Familie für die Kinder an diversen Schulen ist noch in lebhafter Erinnerung. Dazu passt, dass der Bildungssoziologe Professor Marcel Helbig herausgefunden hat: In Ostdeutschland besuchen 30 % aller Akademikerkinder inzwischen eine Privatschule – klar, das sind nicht unbedingt die megateuren Privatschulen, sondern bspw. kirchliche Träger, aber auch da gehen die Kosten pro Jahr in schnell in die Tausende Euro. Warum machen die Eltern das? Weil der Zustand des staatlichen Schulsystems flächendeckend nicht mehr funktioniert, und weil aber natürlich Eltern garantieren wollen, dass ihre Kinder Chancen für die Zukunft haben. Kurzum: Provokant gesagt - Du musst bezahlen, wenn Du junge und motivierte Lehrer für Deine Kinder haben willst – die mlgw. sogar wissen, wie eine APP programmiert wird. Daher ist gemeinsam mit dem Sender die Frage entstanden: Wie eigentlich steht es mit den Aufstiegschancen in Deutschland heute? Oder, wie Angela Merkel einst sinngemäß formulierte: Wer nicht an der Bildungsrepublik Deutschland baut, der riskiert das Vertrauen in das System, in die soziale Marktwirtschaft. Wie weit wir damit gekommen sind, lässt sich ja jeden Tag beobachten.
Welche Erkenntnisse haben mich besonders überrascht?
In Deutschland braucht es nach einer OECD-Studie 6 Generationen für den Aufstieg von der Armut in die Mittelschicht, in Dänemark zu nur 2. Ein Detail: Ein frühes Durchlässigkeitshindernis ist die Selektion der deutschen Gesellschaft im Alter von 10 – beim Übergang von der Grundschule zum Gymnasium, de facto wird die Gesellschaft geteilt. Wir haben mit diesem System: schlechtere Leistungen im Durchschnitt als Länder, die das längere gemeinsame Lernen pflegen, das Land verschwendet unglaubliche viele Talente, sozial Benachteiligte haben es schwerer bei den Lehrern – alles belegt. Was mich überraschte: US-Bildungsexperten versuchten gemeinsam mit preußischen Bildungsreformern bereits nach dem 2. Weltkrieg, in den amerikanischen Besatzungszonen das längere gemeinsame Lernen durchzusetzen – mehr Gemeinsamkeit, weg vom Klassensystem, weil sie fühlten, dass Deutschlands hierarchisches Gesellschaftssystem nicht ganz schuldlos am Führerkult der Deutschen war – das scheiterte an den konservativen Bildungseliten, später am Kalten Krieg.
Warum ist das Aufstiegsversprechen so brüchig?
Welches Kind hat welche Chancen? Soziales, kulturelles, finanzielles Kapital entscheidet darüber, was aus uns wird. Prägung, Elternhaus, Wohnort. Damit Schulwahl, Lehrer, Freunde, Peergroups. Da kommt eine lange Checkliste zusammen. Mit unseren Protagonisten verfolgen wir das – und Du siehst, wie hoch talentierte Menschen am Ende nur noch fighten können und letztlich zu nichts kommen; wenn man Ende der Studienkredit der staatlichen KfW zur Schuldenfalle wird, wie bei zwei unserer Protas; wenn am Ende die Wahl bleibt zwischen 300 EUR für die Tilgung oder 300 EUR für die Altersvorsorge, weil beides nicht geht. Ganz abgesehen vom Eigentumserwerb. Die Sozialwissenschaftlerin Martyna Linartas sagt im Film: „Erbst Du schon oder arbeitest Du noch?“. Es geht hier nicht mehr um Leistung, es geht um Privilegien. Marlen Hobrack sagt es so: „Ich subventioniere mit 9 Prozent Zinsen für meinen Studienkredit die Niedrigzinsen für ökologischen Häusle-Umbau des vermögenden Hausbesitzers.“
Wir haben wir die Protagonisten ausgewählt?
Wir sind letztlich durch lange, intensive Recherchen auf eine Gruppe von Menschen gestoßen, die ganz unterschiedliche Lebensgeschichten haben: Natalya, die, hoch talentiert, am „System“ fast gescheitert wäre, Marlen, die heute sehr stark über die Rückkehr der Klassengesellschaft nachdenkt, Cawa, der 1990 aus Afghanistan kam, zum Manager wurde, Jörg, der mit Anfang 40 immer noch um seine Chance kämpft, Scott Wempe, der im wahrsten Sinne aufgrund des Erbes seiner Familie alle Chancen hatte; seine Beschreibung der Möglichkeiten des englischen Elite-Colleges sprechen für sich – und Stephanie zu Guttenberg, die die soziale Spaltung im Bildungssystem für untragbar hält. Ganz verschiedene Ecken, Herkünfte, Prägungen ...
Wie haben diese Perspektiven das Narrativ geprägt?
Ganz einfach: Es ging darum zu zeigen, was möglich ist - und was unmöglich.
Wie kann das Bildungssystem reformiert werden?
Joe Kaeser, Ex-Siemens-Chef, meinte letzten Sommer, eine Karriere wie die seine, als Arbeiterkind von ganz unten zu kommen und nach ganz oben zu gelangen, sei heute nicht mehr möglich. Sozialwissenschaftler Michael Hartmann bestätigt das im Film.
Kaeser plädiert an anderer Stelle für nicht weniger als eine Art Staatsreform, und das braucht es auch - allein der Föderalismus im Bildungssystem ist ja nach Meinung aller Experten extrem hinderlich. Es braucht hier viel mehr als ein Startchancenprogramm (letzte Bundesregierung) „von oben“ – besser wäre es, auf beispielsweise den Bürgerrat Bildung der privaten Montag-Stiftung zu hören: Die haben alles besprochen, was macht man braucht: Längeres gemeinsames Lernen, natürlich mehr und besser ausgebildete Lehrer, mehr Berufsorientierung, ganz andere Lehrpläne. Sprich: Mehr Demokratie wagen: das ist die Chance der Stunde; alles andere führt wohl in etwas wie den Trumpismus.
Ob Deutschland seine Demokratie verspielt?
Klar. Schon heute wählen die unterprivilegierten Schichten viel seltener als die Gut-Situierten – oder sie wählen neue, andere politische Parteien. Das alte Parteiensystem ist ja, wie wir das in Ostdeutschland sehen, ohnehin kaputt. Studien sagen, dass jedes Prozent Einsparung staatlicher Investitionen zu 3 Prozent mehr Wählerpotential radikaler Parteien führen. Schlechte Schulen, schlechtes Umfeld, Demografie etc. pp. Man kann das ja alles beobachten. Es bräuchte – siehe Bürgerräte – ganz andere Formen demokratischer Mitbestimmung, ein anderes Wir.. Nicht umsonst sind die Schweizer weitaus zufriedener mit ihrer Demokratie – die Volksabstimmung sind ja i. d. R. gut vorbereitete und einen sachlichen Diskurs ermöglichende Abwägungen.
Publikumswirkung?
Ich hoffe, dass die Geschichte der Protagonisten überzeugen – und die Erkenntnisse der Sozialwissenschaftler den einen oder anderen Gedanken anstößt. Es ist ja ein reiner O-Ton-Film, ohne Kommentar - insofern: Botschaften haben nicht wir, sondern unsere Protagonisten. Und die vermitteln sie im Film – hoffentlich verständlich und nachvollziehbar.
Vielen Dank für Ihre Zeit!
Das MDR-Fernsehen zeigt den 90-minütigen Film «You can win if you want? Das falsche Versprechen vom Aufstieg» von Dirk Schneider und Ariane Riecker am 22. Januar um 20.15 Uhr.
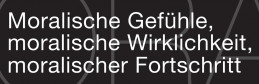







 Netflix erhöht die Preise
Netflix erhöht die Preise 46,8 Millionen Abrufe: «Back in Action» schlägt ein
46,8 Millionen Abrufe: «Back in Action» schlägt ein











 Set-Runner/ Produktionsfahrer (w/m/d) Reality
Set-Runner/ Produktionsfahrer (w/m/d) Reality




Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel