 Aufklärung ist wichtig. Die Neigung betrifft einen kleinen Teil der Bevölkerung und ist nicht selbst gewählt. Statt Stigmatisierung braucht es Aufklärung und Offenheit. Idealerweise beginnen wir mit der Aufklärung schon in der Schule im Sexualkundeunterricht. In dem Fall, von dem wir in unserer Podcast-Folge berichtet haben, hatte der Betroffene bereits in der Pubertät bemerkt, dass bei ihm etwas anders ist: seine Sexualität sich nicht so entwickelt, wie es bei seinen Freunden der Fall war. Sich früh dessen bewusst zu werden. Das ist wichtig, um sich im Idealfall auch frühe Unterstützung zu holen. Es geht darum, mit so einer Neigung zu leben – ohne gleichzeitig oder später Opfer zu erzeugen. Denn Pädophilie an sich ist keine Straftat. Wenn man die Neigung auslebt, dann jedoch sehr wohl.
Aufklärung ist wichtig. Die Neigung betrifft einen kleinen Teil der Bevölkerung und ist nicht selbst gewählt. Statt Stigmatisierung braucht es Aufklärung und Offenheit. Idealerweise beginnen wir mit der Aufklärung schon in der Schule im Sexualkundeunterricht. In dem Fall, von dem wir in unserer Podcast-Folge berichtet haben, hatte der Betroffene bereits in der Pubertät bemerkt, dass bei ihm etwas anders ist: seine Sexualität sich nicht so entwickelt, wie es bei seinen Freunden der Fall war. Sich früh dessen bewusst zu werden. Das ist wichtig, um sich im Idealfall auch frühe Unterstützung zu holen. Es geht darum, mit so einer Neigung zu leben – ohne gleichzeitig oder später Opfer zu erzeugen. Denn Pädophilie an sich ist keine Straftat. Wenn man die Neigung auslebt, dann jedoch sehr wohl.Muss in den Medien genauer zwischen Pädophilie und Hebephilie unterschieden werden? Und was bedeutet das für die journalistische Aufbereitung von Fällen, in denen Jugendliche ab etwa 14 Jahren betroffen sind?
Ja, eine stärkere Differenzierung in der medialen Berichterstattung wäre wünschenswert – auch aus sprachlicher und fachlicher Sicht. Pädophilie beschreibt die sexuelle Anziehung zu vorpubertären Kindern, während Hebephilie sich auf die Anziehung zu pubertierenden Jugendlichen bezieht, meist im Alter zwischen etwa 11 und 14 Jahren.
In der Praxis aber liegt der Fokus der Berichterstattung meist auf der Tat selbst – was nachvollziehbar ist, weil es um konkrete Opfer und Täter geht. Und an der Tatsache, dass es Geschädigte gibt – Kinder oder auch Jugendliche, die oft ihr ganzes Leben schwer unter diesen Taten leiden –, dürfen wir nicht vorbeisehen. Dennoch bleibt dabei oft die differenzierte Einordnung auf der Strecke, die für echte Aufklärung notwendig wäre. Medien können und sollten hier mehr leisten – nicht zur Relativierung, sondern zur sachlichen Orientierung.
Wie sollte man gesellschaftlich und juristisch mit Menschen umgehen, die eine sexuelle Anziehung zu Jugendlichen im Alter von 16 oder 17 empfinden, also kurz vor oder über der gesetzlichen Grenze stehen?
Diese Frage berührt komplexe juristische und ethische Aspekte und sollte daher vor allem von Fachleuten beantwortet werden – etwa von Juristen oder Sexualtherapeuten, die sich intensiv mit dem Thema befassen. Wichtig scheint mir nur: Auch in diesem Graubereich braucht es Sensibilität, klare gesetzliche Orientierung und eine gesellschaftliche Haltung, die Schutzbedürfnisse ernst nimmt, ohne vorschnell zu verurteilen.
In Präventionskampagnen, etwa in Form von Werbespots, wird oft vor "alten Männern im Internet" gewarnt. Dabei zeigen viele Studien, dass Kinder viel häufiger im familiären Umfeld missbraucht werden. Muss hier nicht dringend ein Umdenken stattfinden? Oder gar die Werbespots angepasst werden?
Das ist eine Frage von Zielgruppen – nehme ich an. Hier hat man versucht, junge Menschen im Netz vor Straftätern zur warnen. Wie man Kinder innerhalb von Familien erfolgreich adressiert, dazu weiß ich leider zu wenig.
Sie sprechen in der Folge sehr empathisch über Menschen mit pädophiler Neigung, die sich freiwillig Hilfe suchen. Wie kann man die Hemmschwelle weiter senken, damit Betroffene sich frühzeitig Unterstützung holen – besonders in ländlichen Regionen, wo es oft keine spezialisierten Stellen gibt?
Dem Thema sollte politisch mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Ein erster Schritt wäre, es stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken – etwa durch eine bundesweite Aufklärungskampagne. Das Bundesgesundheitsministerium könnte hier eine Schlüsselrolle übernehmen, indem es klar kommuniziert, wo Betroffene Hilfe finden. Ob das in ländlichen Regionen über Plakate, Postwurfsendungen oder andere Wege geschieht, ist zweitrangig – entscheidend ist, dass überhaupt informiert wird. Wichtig ist auch zu vermitteln: Wer pädophil ist, ist nicht automatisch ein schlechter Mensch oder ein Straftäter. Sondern jemand, der – wenn er aktiv um Hilfe bittet – Unterstützung verdient.
Wie groß ist die Gefahr, dass Menschen mit pädophiler Neigung durch gesellschaftliche Stigmatisierung in die Isolation getrieben werden – und dadurch womöglich eher ein Risiko darstellen, weil sie keinen Ausweg sehen?
Diese Fragestellung ist komplex und wird unter Fachleuten intensiv diskutiert. Wichtig ist es, einen offenen Diskurs ohne Vorverurteilung zu ermöglichen.
In der Folge kommt auch ein junger Mann zu Wort, der sich Hilfe beim Projekt "Kein Täter werden" geholt hat. Haben Sie aus dem Podcast Rückmeldungen bekommen, dass dieser offene Umgang anderen Mut gemacht hat?
Die Folge erschien erst am 23. April – Rückmeldungen liegen daher noch nicht vor. Aber selbstverständlich hoffe ich, wie bei allen unseren Podcast-Episoden, dass auch diese Ausgabe zur Aufklärung beiträgt, zum Nachdenken anregt.
Wie gelingt es, bei einem solch heiklen Thema journalistische Neutralität zu wahren – zwischen notwendiger Aufklärung und der Emotionalität, die mit dem Thema Pädophilie fast automatisch einhergeht?
Wer wirklich verhindern will, dass Kinder zu Opfern werden, muss den Blick auf die Ursachen richten – nicht nur auf die Folgen. Emotionen sind verständlich, aber sie können die Sicht auf notwendige Differenzierungen vernebeln. Das hilft am Ende niemandem.
Im Zuge unserer Recherchen wurde mir schnell klar: Es gibt eine nicht unerhebliche Zahl von Menschen mit pädophiler Neigung, die verantwortungsvoll damit umgehen – weil sie genau wissen, welches Leid sie verursachen würden, wenn sie ihren Impulsen nachgeben. Das verdient Anerkennung, auch wenn es schwer auszuhalten ist. Gleichzeitig ist mir bewusst geworden, wie belastend es sein kann, mit so einer Neigung zu leben – im Verborgenen, oft ohne Austausch, in ständiger Angst, verurteilt oder verlassen zu werden. Diese stille Bürde ist kaum sichtbar – und doch real. Denn dies wünscht sich doch jeder von uns: eine offene und liebevolle Beziehung. Für Menschen mit einer kernpädophilen Neigung scheint das fast unerreichbar.
Wie geht das Team von «Aktenzeichen XY» intern mit diesen Themen um? Gibt es besondere redaktionelle Richtlinien oder auch psychologische Betreuung, wenn sich die Recherchen als emotional belastend erweisen?
Nein, es gibt keine redaktionellen Richtlinien oder psychologische Betreuung dazu. Mir wäre jetzt auch kein Fall bekannt, bei dem das ansatzweise nötig gewesen wäre. Sollte eine Recherche im Einzelfall emotional belasten, ist der kollegiale Austausch oft der naheliegendste und wirksamste Weg, damit umzugehen.
Vielen Dank für Ihre Zeit!








 Fast fünf Millionen Italiener verfolgen Todesmeldung des Papstes
Fast fünf Millionen Italiener verfolgen Todesmeldung des Papstes Nach Thailand mit der Propellermaschine?
Nach Thailand mit der Propellermaschine? 

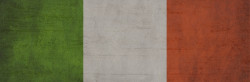








 Senior Video Producer/ 1st TV Operator (m/w/d)
Senior Video Producer/ 1st TV Operator (m/w/d) Pflicht-/Orientierungspraktikant Produktion (w/m/d)
Pflicht-/Orientierungspraktikant Produktion (w/m/d)




Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel