Mehr als 50.000 Soldaten sind derzeit in Deutschland stationiert. In Ramstein ist der wichtigste Luftwaffenstützpunkt der US-Streitkräfte in Europa. Das größte US-Militärkrankenhaus außerhalb der USA befindet sich im benachbartem Landstuhl.
Im Dokumentarfilm «Der innere Krieg» wird die Sickingenstadt Landstuhl zur Plattform unterschiedlicher Geschichten diverser Menschen, die alle etwas gemeinsam haben: Der Krieg, ob er kurz bevorsteht oder vorerst hinter den Personen liegt, fand Einzug in ihr Leben und ließ merkliche Spuren zurück, mit denen sie sich nun arrangieren müssen.
Astrid Schults Werk offenbart die Empfindungen verwundeter Militärpflichtiger, deren Angehörigen, sowie Angestellten des Fisher House. Zwischen den Phasen ihrer Behandlung kommen die Soldaten in genannter Einrichtung unter und versuchen im Folgenden einen gewöhnlichen Alltag zu schaffen und die Geschehnisse des Kampfes entsprechend zu verarbeiten.
Interviews gewähren Einblicke in die Gedanken der Verwandten und Soldaten selbst, die oftmals nur durch den Glauben an den Herrn oder die Mission kompensiert werden können. Beispiele sind Ryan Ferre, dem eine tonnenschwere Luke das Genick brach und der sich nach seiner Genesung zurück in das Gefecht begeben muss, und Timothy Jackson, der in den Irak ziehen und nicht unbedeutende Zeit von seiner Frau getrennt sein wird.
Kritik:
Man muss kein außerordentlich aufmerksamer Zuschauer sein, um beim Betrachten von «Der innere Krieg» zwei elementare Dinge festzustellen: Erstens scheint der Film zahlreiche Aspekte beleuchten und kritisieren zu wollen. Zweitens bleibt er damit vollkommen erfolglos und versäumt ebenso viele Möglichkeiten, aus der durchaus interessanten Thematik informative Zeit der Unterhaltung zu gewinnen.
Der zu 85% untertitelte Dokumentarfilm besticht durch meist ruhige Bilder, die jedoch mehr hätten aufzeigen können. Durch Interviews, die zwar kaum ehrlicher, aber grundsätzlich expressiver und inhaltsträchtiger sein könnten. Durch Menschen, die real aber wenig charismatisch wirken. Letztlich ein Schauspiel verpasster Chancen. Ob ein Voice Over der Arbeit gut getan hätte, bleibt fraglich – Ganz im Gegensatz zur Distanz, die durch das Verzichten auf Namen geschaffen wird. Erst im späteren Verlauf werden einige Vornamen in Gesprächen genannt, Familiennamen darf man von den Uniformen der Soldaten ablesen.
Wenn betroffene Personen wie die Frau Josephs, die ihren Gatten, der schwer geschädigt heimkehrte, kaum noch wieder erkennt oder Bridget, die sowohl im Fisher House, als auch im Hospital mit all diesem Leid konfrontiert wird, ihre Sicht der Dinge schildern, wird deutlich, was Krieg hier darstellt: Ein Phänomen, das die Menschen erfasst und nicht mehr loslässt.
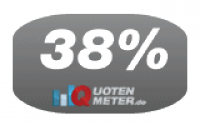 Regisseurin Astrid Schult hätte sich schlicht auf einen der stets angedeuteten Blickwinkel konzentrieren sollen, denn in der vorliegenden Form treibt «Der innere Krieg» wie ein unbeseeltes Stück Treibgut umher. Es existiert keine direkte Absage gegenüber dem Krieg, keine explizite Darstellung der medizischen Therapie oder des Ablaufs im Fischer House und keine wirklich fassbare Botschaft. Selbstverständlich handelt es sich um einen Dokufilm, in dem ohne Zweifel Wahrheit und Leidenschaft stecken, aber weder das, noch die gute Kameraarbeit können darüber hinwegtäuschen, dass es keinerlei Ziel gibt, keine Substanz, die das Publikum berühren kann oder zumindest, etwas Besonderes aufzuzeigen vermag. Ein Stück Treibgut – Es erzählt eine interessante Geschichte, der man zu folgen bereit ist, doch es bleibt, was es ist: Unzureichend.
Regisseurin Astrid Schult hätte sich schlicht auf einen der stets angedeuteten Blickwinkel konzentrieren sollen, denn in der vorliegenden Form treibt «Der innere Krieg» wie ein unbeseeltes Stück Treibgut umher. Es existiert keine direkte Absage gegenüber dem Krieg, keine explizite Darstellung der medizischen Therapie oder des Ablaufs im Fischer House und keine wirklich fassbare Botschaft. Selbstverständlich handelt es sich um einen Dokufilm, in dem ohne Zweifel Wahrheit und Leidenschaft stecken, aber weder das, noch die gute Kameraarbeit können darüber hinwegtäuschen, dass es keinerlei Ziel gibt, keine Substanz, die das Publikum berühren kann oder zumindest, etwas Besonderes aufzuzeigen vermag. Ein Stück Treibgut – Es erzählt eine interessante Geschichte, der man zu folgen bereit ist, doch es bleibt, was es ist: Unzureichend. Das ZDF zeigt «Der innere Krieg» am Dienstag, den 15. Dezember 2009, um 0.30 Uhr.






 Popcorn und Rollenwechsel: ...und Zombies!
Popcorn und Rollenwechsel: ...und Zombies! Sieg klar verpasst: Jauch-Jahresrückblick schwach
Sieg klar verpasst: Jauch-Jahresrückblick schwach










 Pflichtpraktikant Spiele Redaktion (w/m/d)
Pflichtpraktikant Spiele Redaktion (w/m/d)



