Vollkommen von der digitalen Welt aufgesogen werden. Dieses Gefühl sollten die meisten von uns bereits verspürt haben. Sei es das faszinierende Videospiel, das uns nicht loslässt, oder stundenlanges Verschlingen kaum nützlichen Wissens bei Wikipedia, obwohl man ja eigentlich nur schnell eine Kleinigkeit nachschlagen wollte. Und die Programmierer unter uns gingen garantiert öfter als einmal in ihren endlosen Codierungen verloren.
 Das Gedankenkonzept des den Menschen absorbierenden Computers ist fast so alt, wie der erste Personalcomputer von IBM. 1982 nahm der mittlerweile zum Kult avancierte Film «Tron» diese Idee wortwörtlich und erzählte vom Spielprogrammierer Kevin Flynn, der vom Chef der Software-Firma ENCOM betrogen wurde und beim Versuch, sich ins System zu hacken vom tyrannischen Master Control Program zum Schutze heikler Daten dematerialisiert, beziehungsweise digitalisiert wird. In der Welt innerhalb des Computers entdeckt Flynn, dass Videospiele brutale Gladiatorenkämpfe sind und Computerprogramme als Abbilder ihrer Schöpfer ein semi-eigenständiges Leben führen. Unter dem diktatorischen Regime des MCPs ist das Leben auf dem ENCOM-Server zu einer Qual geworden, und als zum Programm verwandelter User leitet Flynn den digitalen Aufstand der Gladiatoren an, um das System wieder nutzerfreundlicher zu gestalten – und um sein Leben zu bewahren.
Das Gedankenkonzept des den Menschen absorbierenden Computers ist fast so alt, wie der erste Personalcomputer von IBM. 1982 nahm der mittlerweile zum Kult avancierte Film «Tron» diese Idee wortwörtlich und erzählte vom Spielprogrammierer Kevin Flynn, der vom Chef der Software-Firma ENCOM betrogen wurde und beim Versuch, sich ins System zu hacken vom tyrannischen Master Control Program zum Schutze heikler Daten dematerialisiert, beziehungsweise digitalisiert wird. In der Welt innerhalb des Computers entdeckt Flynn, dass Videospiele brutale Gladiatorenkämpfe sind und Computerprogramme als Abbilder ihrer Schöpfer ein semi-eigenständiges Leben führen. Unter dem diktatorischen Regime des MCPs ist das Leben auf dem ENCOM-Server zu einer Qual geworden, und als zum Programm verwandelter User leitet Flynn den digitalen Aufstand der Gladiatoren an, um das System wieder nutzerfreundlicher zu gestalten – und um sein Leben zu bewahren.Der Vater: Das einvernehmende Relikt seiner Zeit
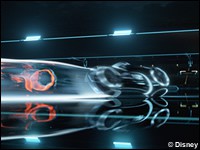 «Tron» war seiner Zeit weit voraus und ein passabler Erfolg an den Kinokassen. Als zunehmend mehr Menschen eigene Erfahrungen mit Computern sammelten und die 80er-Jahre zur Vergangenheit wurde, stieg die Popularität der ungewöhnlichen Disney-Produktion. Das außergewöhnliche Design wickelte Neugierige um den Finger, während die unaufhaltsame Computerisierung des Alltags auch den Grundgedanken von «Tron» zugänglicher machte. Was «Tron» daran hindert, vom Nischenkultfilm zum allseits verehrten Klassiker aufzusteigen, ist neben der rapiden Alterung seiner einstmals revolutionären Technik, sein unterentwickeltes Drehbuch. Die ambitionierten Ideen sind vorhanden, bloß sind sie verpackt in einer unaufregend erzählten und mit austauschbaren Figuren ausgestatteten Geschichte.
«Tron» war seiner Zeit weit voraus und ein passabler Erfolg an den Kinokassen. Als zunehmend mehr Menschen eigene Erfahrungen mit Computern sammelten und die 80er-Jahre zur Vergangenheit wurde, stieg die Popularität der ungewöhnlichen Disney-Produktion. Das außergewöhnliche Design wickelte Neugierige um den Finger, während die unaufhaltsame Computerisierung des Alltags auch den Grundgedanken von «Tron» zugänglicher machte. Was «Tron» daran hindert, vom Nischenkultfilm zum allseits verehrten Klassiker aufzusteigen, ist neben der rapiden Alterung seiner einstmals revolutionären Technik, sein unterentwickeltes Drehbuch. Die ambitionierten Ideen sind vorhanden, bloß sind sie verpackt in einer unaufregend erzählten und mit austauschbaren Figuren ausgestatteten Geschichte. Wir leben aber nicht mehr im Kinoalltag, aus dem «Tron» hervorstach. Computeranimationen drängten erst handgemachte Spezialeffekte, und dann den Zeichentrickfilm an den Rand. Digitale Sets sind keine Besonderheit mehr. «Matrix» belebte den Cyberpunk neu, der nahezu komplett digitale «Avatar» ist der momentan größte kommerzielle Filmerfolg. Und Videospiele sind schon längst kein Nischenmarkt mehr. Kurzum: Wir leben in der Zeit, in die «Tron» hineingepasst hätte. Für Hollywood Anlass genug, das alte System aus dem Keller zu holen, abzustauben, neu zu booten und mit zahlreichen Updates zu versehen. Das Ergebnis: «Tron: Legacy»; audiovisuelle Neuinterpretation, inhaltliche Fortsetzung.
 Dass «Tron: Legacy» den 80er-Jahren entstammt, merkt man ihm sogar wesentlich deutlicher an, als einen die filmische Oberfläche zunächst vermuten lässt. Wie schon «Tron» geht auch dieses Science-Fiction/Fantasy-Werk mit einer hohen Selbstverständlichkeit an seine Vorstellung einer lebendigen und stark vermenschlichten Computerwelt um. Erklärungen gibt es nicht, das Kinopublikum muss sich ohne Hilfestellung mit der Filmidee arrangieren. Außerdem ist die digitale Welt, in die auch dieses Mal der Protagonist gesogen wird, nicht mit dem Internet verbunden – immerhin einer der wenigen Konzeptpunkte, die während des Films begründet werden. Auch ist «Tron: Legacy» stilistisch und charakteristisch eine konsequente Weiterführung von «Tron», so als hätte es die letzten 28 Jahre Filmgeschichte nicht gegeben. «Tron: Legacy» ist im besten, einen 80er-Jahre-Charme versprechenden, Sinne sperrig. In einer Nachrichten-Monatge zu Beginn des Films begnügt sichRegisseur Joseph Kosinski etwa nicht damit, wie viele andere Filmemacher einfach auf grobkörniges Videomaterial zu schneiden. Stattdessen zeigt er einen schwarzen Raum, voll besetzt mit alten Röhrenfernsehern, die sich von selbst einschalten, während auf eines der Geräte zoomt. Hier spürt man, dass «Tron: Legacy» eine simple Popcorn-Handlung mit größeren Ambitionen zu vereinen versucht. Solche Momente, in denen «Tron: Legacy» wie ein verfilmter Ausflug in eine moderne Kunstausstellung zum Thema Massenmedien anfühlt, sind leider zu rar gesät, als dass sie zum stilprägenden Element von «Tron: Legacy» werden.
Dass «Tron: Legacy» den 80er-Jahren entstammt, merkt man ihm sogar wesentlich deutlicher an, als einen die filmische Oberfläche zunächst vermuten lässt. Wie schon «Tron» geht auch dieses Science-Fiction/Fantasy-Werk mit einer hohen Selbstverständlichkeit an seine Vorstellung einer lebendigen und stark vermenschlichten Computerwelt um. Erklärungen gibt es nicht, das Kinopublikum muss sich ohne Hilfestellung mit der Filmidee arrangieren. Außerdem ist die digitale Welt, in die auch dieses Mal der Protagonist gesogen wird, nicht mit dem Internet verbunden – immerhin einer der wenigen Konzeptpunkte, die während des Films begründet werden. Auch ist «Tron: Legacy» stilistisch und charakteristisch eine konsequente Weiterführung von «Tron», so als hätte es die letzten 28 Jahre Filmgeschichte nicht gegeben. «Tron: Legacy» ist im besten, einen 80er-Jahre-Charme versprechenden, Sinne sperrig. In einer Nachrichten-Monatge zu Beginn des Films begnügt sichRegisseur Joseph Kosinski etwa nicht damit, wie viele andere Filmemacher einfach auf grobkörniges Videomaterial zu schneiden. Stattdessen zeigt er einen schwarzen Raum, voll besetzt mit alten Röhrenfernsehern, die sich von selbst einschalten, während auf eines der Geräte zoomt. Hier spürt man, dass «Tron: Legacy» eine simple Popcorn-Handlung mit größeren Ambitionen zu vereinen versucht. Solche Momente, in denen «Tron: Legacy» wie ein verfilmter Ausflug in eine moderne Kunstausstellung zum Thema Massenmedien anfühlt, sind leider zu rar gesät, als dass sie zum stilprägenden Element von «Tron: Legacy» werden.Vor allem zeigt sich die Vorlagentreue von «Tron: Legacy» in seiner Bildsprache und -konzeption. Statt die Welt innerhalb des Computers den Standards moderner Videospiele gemäß hyperreal darzustellen, übernimmt man die visuellen Grundideen des Vorgängers und setzt sie mit den heutigen Möglichkeiten ausschweifender und eleganter um. «Tron» vereinte Disco-ästhetischen Futurismus mit einem zur Kunstform hochstilisierten Arcade-Look, «Tron: Legacy» aktualisiert ihn mit einigen Grundregeln der Apple-Schönheitsgesetze und transferiert dies zu einem größenwahnsinnigen Minimalismus.
Der Sohn: Der rebellische Jungspund
 Wenige Jahre nach den Ereignissen von «Tron» führt Kevin Flynn ein erfolgreiches Leben als Familienvater und Chef der Firma ENCOM. Eines Nachts verschwindet er spurlos und erst zwanzig Jahre später erhält sein Sohn Sam wieder ein Lebenszeichen von ihm. Eine Pager-Nachricht führt Sam in die alte Arcade seines Vaters, wo er ein geheimes Büro entdeckt und in die digitale Welt gesogen wird. Unmittelbar nach seiner Ankunft wird Sam Flynn von Kontrollprogrammen gefangen genommen, bald darauf wird ihm eine neue Identität als Spieleprogramm zugeteilt. Auf dem Spieleraster soll er zur allgemeinen Belustigung in Kämpfen auf Leben und Tod antreten. Sam kann mit Hilfe eines mysteriösen Programms fliehen und macht sich auf dem Weg zu seinem Vater. Wie Sam bald erfährt, lebt dieser als gestürzter Schöpfer seiner Parallelwelt im Exil, unfähig, den Computer wieder zu verlassen.
Wenige Jahre nach den Ereignissen von «Tron» führt Kevin Flynn ein erfolgreiches Leben als Familienvater und Chef der Firma ENCOM. Eines Nachts verschwindet er spurlos und erst zwanzig Jahre später erhält sein Sohn Sam wieder ein Lebenszeichen von ihm. Eine Pager-Nachricht führt Sam in die alte Arcade seines Vaters, wo er ein geheimes Büro entdeckt und in die digitale Welt gesogen wird. Unmittelbar nach seiner Ankunft wird Sam Flynn von Kontrollprogrammen gefangen genommen, bald darauf wird ihm eine neue Identität als Spieleprogramm zugeteilt. Auf dem Spieleraster soll er zur allgemeinen Belustigung in Kämpfen auf Leben und Tod antreten. Sam kann mit Hilfe eines mysteriösen Programms fliehen und macht sich auf dem Weg zu seinem Vater. Wie Sam bald erfährt, lebt dieser als gestürzter Schöpfer seiner Parallelwelt im Exil, unfähig, den Computer wieder zu verlassen.Trotz seiner unübersehbaren Abstammung vom Original, ist «Tron: Legacy» auch unmissverständlich ein Produkt unserer Zeit. Die Computereffekte sind auf dem Stand der Technik und es wurde eine digitale Parallelwelt von tief reichenden Dimensionen sowie mit gelungenen 3D-Effekten erschaffen. «Tron» erstaunte 1982 wegen seiner Innovation, etwas, das «Tron: Legacy» nicht mehr erreichen kann und mit Pomp kompensiert. Die dynamische Kamera fliegt in den Actionszenen über riesige, meistens am Computer entstandene, Sets hinweg; überhaupt ist der Action-Anteil in «Tron: Legacy» viel größer und elaborierter als in seinem Vorläufer. «Tron: Legacy» hat eine größere Mythologie, auf die er sporadisch verweist, und nutzt das moderne Verständnis für Computer, um das Originalkonzept von «Tron» weiter auszuarbeiten. Und da die Pioniertage des Computerzeitalters vorbei sind, schlägt «Tron: Legacy» einen konsequent düsteren Ton an. Die humorigen Einschübe sind nun deutlicher, als in «Tron», aber der Grundtenor ist phasenweise sogar zu ernst, insbesondere gegen Schluss.
 Statt des kühl-kultigen und eher zurückhaltenden Scores von Wendy Carlos dröhnt in «Tron: Legacy» nahezu unentwegt die Musik der beliebten französischen Elektrokombo Daft Punk aus den Lautsprechern. Diese ist für viele Kinogänger das nachvollziehbare Hauptargument von «Tron: Legacy». Guy-Manuel de Homem-Christo und Thomas Bangalter sind eingeschworene Fans von «Tron» und gingen mit entsprechendem Herzblut an die Komposition der Filmmusik dessen Fortsetzung. Sie verschmolzen ihren eigenen Stil mit dem schwellenden Orchester klassischer Hollywood-Epen, der Düsternis eines John-Carpenter-Soundtracks und der Wucht größerer Hans-Zimmer-Kompositionen zu einem außergewöhnlichen Klangbett. Wobei Klangbett sicherlich die falschen Assoziationen weckt, denn entgegen aller filmischen Grundgesetze dient der Soundtrack von «Tron: Legacy» nicht zur Verstärkung seiner gezeigten Bilder. Daft Punks schon während der Skriptphase entworfenen Kompositionen sind viel mehr die treibende Kraft von «Tron: Legacy». Die Abstimmung zwischen Klang und Bild ist phänomenal, lässt «Tron: Legacy» fast schon wie das längste und teuerste Musikvideo der Welt wirken. Das ist gewiss das Todesargument für jeden, der weder mit der Bildästhetik, noch mit der Klangwelt des Films etwas anfangen kann. Gleichermaßen wird diese Megaproduktion dadurch für jene, die für den Stil von «Tron: Legacy» empfänglich sind, über jeden Zweifel emporgehoben. Es ist ein Rave von einem Film.
Statt des kühl-kultigen und eher zurückhaltenden Scores von Wendy Carlos dröhnt in «Tron: Legacy» nahezu unentwegt die Musik der beliebten französischen Elektrokombo Daft Punk aus den Lautsprechern. Diese ist für viele Kinogänger das nachvollziehbare Hauptargument von «Tron: Legacy». Guy-Manuel de Homem-Christo und Thomas Bangalter sind eingeschworene Fans von «Tron» und gingen mit entsprechendem Herzblut an die Komposition der Filmmusik dessen Fortsetzung. Sie verschmolzen ihren eigenen Stil mit dem schwellenden Orchester klassischer Hollywood-Epen, der Düsternis eines John-Carpenter-Soundtracks und der Wucht größerer Hans-Zimmer-Kompositionen zu einem außergewöhnlichen Klangbett. Wobei Klangbett sicherlich die falschen Assoziationen weckt, denn entgegen aller filmischen Grundgesetze dient der Soundtrack von «Tron: Legacy» nicht zur Verstärkung seiner gezeigten Bilder. Daft Punks schon während der Skriptphase entworfenen Kompositionen sind viel mehr die treibende Kraft von «Tron: Legacy». Die Abstimmung zwischen Klang und Bild ist phänomenal, lässt «Tron: Legacy» fast schon wie das längste und teuerste Musikvideo der Welt wirken. Das ist gewiss das Todesargument für jeden, der weder mit der Bildästhetik, noch mit der Klangwelt des Films etwas anfangen kann. Gleichermaßen wird diese Megaproduktion dadurch für jene, die für den Stil von «Tron: Legacy» empfänglich sind, über jeden Zweifel emporgehoben. Es ist ein Rave von einem Film.Das Duplikat: Gescheitertes Streben nach Perfektion
Kevin Flynns digitales Abbild, das Programm C.L.U., sollte ihm dabei helfen, die perfekte Welt zu erschaffen. Das Streben nach Perfektion nahm eines Tages überhand, und C.L.U. wendete sich gegen seinen makelbehafteten Schöpfer sowie Teile seiner Schöpfung. Gemeinsam mit seinem Sohn Sam und der kämpferischen Quorra versucht Kevin Flynn seine fatalste Kreation aufzuhalten.
 Die Figur des C.L.U. steht sinnbildlich für das gescheiterte Perfektionsstreben der «Tron: Legacy»-Macher. Für die Darstellung von C.L.U. wurde Jeff Bridges’ Gesicht nach den Dreharbeiten am Computer verjüngt. In seinen besten Momenten ist dieser Effekt beeindruckend, in seinen schlechtesten lenkt er vom eigentlichen Leinwandgeschehen ab, da er die Details der menschlichen Mimik und Gestik verfälscht. Viele US-Zuschauer mokierten sich in Internetforen bereits über diesen peinlichen Effekt. Dabei befindet er sich, betrachtet man ihn allein, ungefähr auf Augenhöhe mit dem stark verjüngten Brad Pitt in «Der seltsame Fall des Benjamin Button». Bloß waren die Köpfe hinter «Tron: Legacy» zu selbstbewusst, gaben C.L.U. lange und dramatische Monologe, statt ihn wie Teenie-Brad-Pitt kurz im Halbschatten zu zeigen. Hinzu kommt, dass dieser Effekt schwankender Qualität von zahllosen atemberaubenden Effekten umgeben ist, und umso mehr ins Auge sticht. Die Verantwortlichen wollten sich mit C.L.U. zu viel selbst beweisen. Man hätte Jeff Bridges auch einfach den Bart rasieren und etwas schmeichelhaftes Make-Up verpassen könne. Das wäre weniger engagiert, doch es hätte «Tron: Legacy» viel weniger Prügel eingebracht.
Die Figur des C.L.U. steht sinnbildlich für das gescheiterte Perfektionsstreben der «Tron: Legacy»-Macher. Für die Darstellung von C.L.U. wurde Jeff Bridges’ Gesicht nach den Dreharbeiten am Computer verjüngt. In seinen besten Momenten ist dieser Effekt beeindruckend, in seinen schlechtesten lenkt er vom eigentlichen Leinwandgeschehen ab, da er die Details der menschlichen Mimik und Gestik verfälscht. Viele US-Zuschauer mokierten sich in Internetforen bereits über diesen peinlichen Effekt. Dabei befindet er sich, betrachtet man ihn allein, ungefähr auf Augenhöhe mit dem stark verjüngten Brad Pitt in «Der seltsame Fall des Benjamin Button». Bloß waren die Köpfe hinter «Tron: Legacy» zu selbstbewusst, gaben C.L.U. lange und dramatische Monologe, statt ihn wie Teenie-Brad-Pitt kurz im Halbschatten zu zeigen. Hinzu kommt, dass dieser Effekt schwankender Qualität von zahllosen atemberaubenden Effekten umgeben ist, und umso mehr ins Auge sticht. Die Verantwortlichen wollten sich mit C.L.U. zu viel selbst beweisen. Man hätte Jeff Bridges auch einfach den Bart rasieren und etwas schmeichelhaftes Make-Up verpassen könne. Das wäre weniger engagiert, doch es hätte «Tron: Legacy» viel weniger Prügel eingebracht.Was sich viel weniger entschuldigen lässt, als der unecht wirkende Verjüngungseffekt, ist das Drehbuch. Als audiovisuell geprägtes Sci-Fi-Actionspektakel muss man von «Tron: Legacy» keine Oscar-würdige Dramaturgie mit einsichtsvollen Figuren und erstaunlichen Handlungswendungen erwarten. Doch das Drehbuch des «Lost»-Autorenduos Adam Horowitz und Edward Kitsis bleibt meilenweit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Der Narrative des Films ist “flüssig” wohl ein Fremdbegriff: Die holpernden Aktübergänge sorgen dafür, dass die Gesamtdramaturgie trotz der gelungenen Einzelpassagen sehr hölzern und ausgewalzt wirkt. Und obwohl «Tron: Legacy» keine Aneinanderreihung für sich stehender Kapitel darstellt, sondern eine zusammenhängende Geschichte erzählen will, wirkt er wie eine Sammlung thematisch verwandter Sequenzen, die lediglich durch die vom Regisseur gewählte Ordnung ein Cyberpunk-Epos erzählen.
Die zwischenzeitlich sehr flachen Dialoge wiederum halten dem Zuschauer die Figuren viel zu sehr auf Distanz, statt sie einem, wie offenbar intendiert, ans Herz gehen zu lassen. Somit bleibt vor allem das Finale viel zu kühl, da die dramatische Komponente nicht aufgeht, während die Enthüllungen über die Pläne des Bösewichts aus einem vollkommen anderen Film entflohen scheinen.
Die Nutzeranwendung: Wer genügt den Kompatibilitätsanforderungen?
 Was «Tron: Legacy» sehr vielen Fortsetzungen voraus hat: Er ist ohne jegliche Kenntnisse des ersten Teils verständlich. Wer «Tron» gesehen hat, kann sich immerhin über einige Anspielungen auf den Kultfilm freuen und dürfte sich auch schneller mit den Ideen von «Tron: Legacy» arrangieren. Generell hat «Tron: Legacy» das Potential, dem Publikum besser zu gefallen, als «Tron». Insbesondere, wenn man bei letzterem die Fraktion ausklammert, die ihn einzig und allein wegen seines Retrocharmes genießt. Die IMDb-Werte für beide Produktionen scheinen dies zu bestätigen.
Was «Tron: Legacy» sehr vielen Fortsetzungen voraus hat: Er ist ohne jegliche Kenntnisse des ersten Teils verständlich. Wer «Tron» gesehen hat, kann sich immerhin über einige Anspielungen auf den Kultfilm freuen und dürfte sich auch schneller mit den Ideen von «Tron: Legacy» arrangieren. Generell hat «Tron: Legacy» das Potential, dem Publikum besser zu gefallen, als «Tron». Insbesondere, wenn man bei letzterem die Fraktion ausklammert, die ihn einzig und allein wegen seines Retrocharmes genießt. Die IMDb-Werte für beide Produktionen scheinen dies zu bestätigen. «Tron: Legacy» hat die bessere Action und zumindest in den längeren Einzelsequenzen auch mehr Spannung, als sein Vorläufer. Außerdem hat die Fortsetzung eine schärfere Charakterzeichnung. Verkamen in «Tron» die meisten Figuren zu einer einheitlichen Masse, stechen in «Tron: Legacy» immerhin der zum Computer-Zenmeister gewandelte Kevin Flynn (Jeff Bridges in einer sympathischen, wenngleich routinierten Post-Dude-Darbietung), die kindlich-naive Amazone Quorra (von Olivia Wilde mit erstaunlicher Hingabe gespielt) sowie Michael Sheens viel zu kurz auftauchender Castor hervor. Letzterer scheint der personifizierte Versuch zu sein, den rückblickend unbeholfenen Charme und die Exzentrik des Originals in das zeitgemäße und ernstere Gesamtbild von «Tron: Legacy» einzugliedern und verleiht mit seinem grell übertriebenen Spiel und seiner selbstironischen Extravaganz dem «Tron»-Universums einen dringend nötigen, charakterlichen Farbtupfer.
Wegen der mitunter schalen Dialoge und der hapernden Gesamtdramaturgie ist «Tron: Legacy» als Unterhaltungsfilm ein klarer Fall für den Anwendungsbefehl: “Beim Kinobesuch bitte 3D-Brille gegen Hirn austauschen!” Dann erlebt man «Tron: Legacy» als eine die Sinne vernebelnde 3D-Achterbahnfahrt durch eine retrofuturistische Kunstinstallation, die ihre audiovisuell überwältigende Wirkung über eine greifbar eingefangene und ausgeklügelte Geschichte stellt.
 Als Kunstwerk und filmisches Experiment, als welches immer mehr Cineasten den Original-«Tron» zu betrachten gewillt sind, wird «Tron: Legacy» hingegen seine Zeit benötigen, um anerkannt zu werden, sollte ihm dieser Aufstieg überhaupt je gelingen. Schließlich verschenkte «Tron: Legacy» die Möglichkeit, einen intelligenten und wohl kreierten Plot zu erzählen. Eine gewisse Chance besteht trotzdem, denn hinter der dröhnenden und schimmernden Fassade seiner simpel gestrickten Blockbuster-Geschichte (sowie sehr offensichtlicher politischer Symbolik im dritten At) entfalten sich sehr abstrahiert behandelte Gedanken über die Natur der Computertechnologie und der Abhängigkeit, in der die Gesellschaft zu ihr steht. Obwohl das Internet keine Bedeutung für den Plot von «Tron: Legacy» hat, so wird es dennoch im Film behandelt. Dieser weiterführende Sinn von «Tron: Legacy» ist nicht so ausgearbeitet und tief greifend, wie er sein könnte, dennoch ist er vorhanden und wird in einer kunstästhetisch interessant gestalten Filmwelt erörtert. «Tron: Legacy» ist also intelligenter, als man beim Anblick seiner konventionellen und tönend erzählten Geschichte denken mag. Allerdings ist er auch nicht so smart, wie er sich hält, weshalb nur die Zeit verraten wird, welchen Respekt sich Produktion noch erarbeiten wird.
Als Kunstwerk und filmisches Experiment, als welches immer mehr Cineasten den Original-«Tron» zu betrachten gewillt sind, wird «Tron: Legacy» hingegen seine Zeit benötigen, um anerkannt zu werden, sollte ihm dieser Aufstieg überhaupt je gelingen. Schließlich verschenkte «Tron: Legacy» die Möglichkeit, einen intelligenten und wohl kreierten Plot zu erzählen. Eine gewisse Chance besteht trotzdem, denn hinter der dröhnenden und schimmernden Fassade seiner simpel gestrickten Blockbuster-Geschichte (sowie sehr offensichtlicher politischer Symbolik im dritten At) entfalten sich sehr abstrahiert behandelte Gedanken über die Natur der Computertechnologie und der Abhängigkeit, in der die Gesellschaft zu ihr steht. Obwohl das Internet keine Bedeutung für den Plot von «Tron: Legacy» hat, so wird es dennoch im Film behandelt. Dieser weiterführende Sinn von «Tron: Legacy» ist nicht so ausgearbeitet und tief greifend, wie er sein könnte, dennoch ist er vorhanden und wird in einer kunstästhetisch interessant gestalten Filmwelt erörtert. «Tron: Legacy» ist also intelligenter, als man beim Anblick seiner konventionellen und tönend erzählten Geschichte denken mag. Allerdings ist er auch nicht so smart, wie er sich hält, weshalb nur die Zeit verraten wird, welchen Respekt sich Produktion noch erarbeiten wird.Fazit: «Tron: Legacy» ist ein Lehrbuchbeispiel für Filme, die man liebt oder schnell wieder verdrängen möchte. Mit seinen mitreißenden Actionsequenzen und der imponierenden Effektarbeit sowie einem bombastischen Score von Daft Punk ist «Tron: Legacy» ein berauschendes, aber nährwertarmes Sci-Fi-Spektakel, das an der Figureninteraktion krankt und dessen Einzelsequenzen wesentlich stärker, als die Gesamthandlung sind. Wem der Look überhaupt nicht zusagt, wird «Tron: Legacy» verabscheuen. Wer «Tron», Daft Punk und/oder die Bilderflut der «Tron: Legacy»-Trailer liebt, sollte ihn dagegen auf der großen Leinwand in 3D erleben und sich mitreißen lassen.
«Tron: Legacy» ist seit dem 27. Januar in vielen deutschen Kinos zu sehen.








 «Besser Essen» kehrt zu ProSieben zurück
«Besser Essen» kehrt zu ProSieben zurück Sat.1 streicht Krimiserien-Samstag
Sat.1 streicht Krimiserien-Samstag
















