 Kaum ein anderer deutscher Filmstar spaltet die Gemüter derart wie Multitalent Til Schweiger. Während ihn die einen als genialen und charismatischen Filmemacher vor und hinter der Kamera schätzen, halten ihn die anderen für unbegabt, selbstverliebt und peinlich. Egal, welchem Lager man sich zugehörig fühlen mag, Fakt ist auf jeden Fall, dass Schweiger es immer wieder aufs Neue versteht, die Zuschauer hierzulande in Scharen in die Kinos zu locken. Seine drei letzten Regiearbeiten konnten insgesamt über zwölf Millionen Besucher verzeichnen. Auch seinem neuesten Werk «Kokowääh», bei dem er erneut als Regisseur, Autor, Produzent und Hauptdarsteller agierte, dürfte ein Erfolg beschieden sein, bedient er sich doch ähnlicher Zutaten wie Schweigers Erfolgskomödien «Keinohrhasen» (2007) und «Zweiohrküken» (2009). Im qualitativen Vergleich zu diesen zieht «Kokowääh» jedoch trotz guter Darsteller und der nett gemeinten Botschaft eindeutig den Kürzeren.
Kaum ein anderer deutscher Filmstar spaltet die Gemüter derart wie Multitalent Til Schweiger. Während ihn die einen als genialen und charismatischen Filmemacher vor und hinter der Kamera schätzen, halten ihn die anderen für unbegabt, selbstverliebt und peinlich. Egal, welchem Lager man sich zugehörig fühlen mag, Fakt ist auf jeden Fall, dass Schweiger es immer wieder aufs Neue versteht, die Zuschauer hierzulande in Scharen in die Kinos zu locken. Seine drei letzten Regiearbeiten konnten insgesamt über zwölf Millionen Besucher verzeichnen. Auch seinem neuesten Werk «Kokowääh», bei dem er erneut als Regisseur, Autor, Produzent und Hauptdarsteller agierte, dürfte ein Erfolg beschieden sein, bedient er sich doch ähnlicher Zutaten wie Schweigers Erfolgskomödien «Keinohrhasen» (2007) und «Zweiohrküken» (2009). Im qualitativen Vergleich zu diesen zieht «Kokowääh» jedoch trotz guter Darsteller und der nett gemeinten Botschaft eindeutig den Kürzeren.Im Mittelpunkt der Tragikomödie steht der erfolglose Drehbuchautor Henry (Til Schweiger), der sein einsames Dasein mit One-Night-Stands und dem Schreiben einer von der Absetzung bedrohten Fernsehserie fristet. Doch das Blatt scheint sich wieder zu wenden, als er plötzlich das Angebot bekommt, den aktuellen Beststeller einer gefeierten Schriftstellerin (Jasmin Gerat) für die große Leinwand zu adaptieren. Einziger Haken an der Sache: Bei der Autorin handelt es sich um seine Ex-Freundin Katharina, mit der er nun gemeinsam das geplante Skript anfertigen soll. Die beiden kommen jedoch erstaunlicherweise gut miteinander klar.
 Aber schon bald steht ein ganz anderes Problem im wahrsten Sinne des Wortes vor Henrys Tür. Die achtjährige Magdalena (Emma Schweiger) behauptet, seine leibliche Tochter zu sein und soll nun für die kommenden Wochen bei ihm wohnen. Ihre Mutter (Meret Becker) musste kurzfristig nach New York und deren Ehemann (Samuel Finzi) ist mit der neuen Situation emotional überfordert, hielt er sich doch selbst bis vor kurzem noch für Magdalenas leiblichen Vater. Henry baut schnell ein gutes Verhältnis zu dem aufgeweckten Kind auf und muss sich fortan nicht nur darum bemühen, im Filmgeschäft wieder fußzufassen, sondern auch Verantwortung für seine Tochter zu übernehmen.
Aber schon bald steht ein ganz anderes Problem im wahrsten Sinne des Wortes vor Henrys Tür. Die achtjährige Magdalena (Emma Schweiger) behauptet, seine leibliche Tochter zu sein und soll nun für die kommenden Wochen bei ihm wohnen. Ihre Mutter (Meret Becker) musste kurzfristig nach New York und deren Ehemann (Samuel Finzi) ist mit der neuen Situation emotional überfordert, hielt er sich doch selbst bis vor kurzem noch für Magdalenas leiblichen Vater. Henry baut schnell ein gutes Verhältnis zu dem aufgeweckten Kind auf und muss sich fortan nicht nur darum bemühen, im Filmgeschäft wieder fußzufassen, sondern auch Verantwortung für seine Tochter zu übernehmen. Dabei stößt der Zuschauer während der zweistündigen Laufzeit von «Kokowääh» auf viel Bekanntes. Dies betrifft zuallererst die Machart und den Look des Films, dessen Bilder auch genauso gut in «Keinohrhasen» und «Zweiohrküken» hätten untergebracht werden können. Ansehnliche Hochglanzbilder, viele Großaufnahmen und der häufige Einsatz langer Brennweiten, die zu einer extremen Unschärfe in der Tiefe führen, sind inzwischen zum Markenzeichen von Schweigers Inszenierungen geworden. Und auch diesmal ist das vor allem in Verbindung mit den prächtigen Schauplätzen und stimmungsvollen Sets wieder schön anzusehen. So kann man von Schweiger und seinen darstellerischen Fähigkeiten halten, was man will, als Regisseur versteht er sein Handwerk zweifellos, selbst wenn er seit seinen vorangegangenen Filmen scheinbar nichts Neues hinzugelernt hat. Letzteres trifft auch auf weitere gestalterische Elemente von «Kokowääh» zu. Dies reicht von der Einblendung der Titel zu Anfang des Films, über den exzessiven Einsatz poppiger Rockschnulzen als musikalische Begleitung (auch OneRepublic ist wieder mit dabei) bis hin zu Til Schweigers Outfit.
Dabei wird jedoch auch keineswegs versucht, die äußerlichen Parallelen zu früheren Produktionen des 47-jährigen Filmemachers zu verschleiern. Vielmehr werden sie bewusst genutzt, um ein weiteres Mal an ein bewährtes Erfolgsrezept anzuknüpfen. Dies setzt sich auch in dem Auftreten von Til Schweigers Tochter Emma fort, die nach ihren sehr wohlwollend aufgenommenen Darbietungen in «Keinohrhasen» und «Zweiohrküken» nun ihre erste Hauptrolle verpasst bekommen hat und diese trotz einiger allzu auswendig wirkender Dialogzeilen mit Bravour meistert.
 Bedauerlicherweise beschränken sich die Gemeinsamkeiten mit früheren Werken Schweigers aber nicht nur auf Äußerlichkeiten. Auch inhaltlich verfallen er und Co-Autor Béla Jarzyk, Schweigers ehemaliger Agent, an vielen Stellen althergebrachten Ideen, auch wenn der Fokus der Geschichte dieses Mal generell wieder stärker auf ihrem tragischen Aspekt liegt. Den Anfang macht hierbei die von Til Schweiger verkörperte Hauptfigur, bei der es sich einmal mehr um einen machohaften Womanizer handelt, der im Grunde aber herzensgut ist und dies durch zunehmend verantwortungsvolles und pflichtbewusstes Handeln letztendlich auch wieder nach außen kehren kann. Abgesehen von den damit verbundenen erneut zur Anwendung kommenden Erzählmustern eigener Produktionen hat sich Schweiger noch mehr als zuvor bei abgedroschenen Versatzstücken des Genres im Allgemeinen bedient. Spätestens wenn er es ein weiteres Mal für nötig hält, abgenutzte Klischees über geschlechterspezifisches Verhalten zum Besten zu geben, bekommt man den Eindruck, mit dem Dargebotenen schon anderswo zur Genüge konfrontiert gewesen zu sein.
Bedauerlicherweise beschränken sich die Gemeinsamkeiten mit früheren Werken Schweigers aber nicht nur auf Äußerlichkeiten. Auch inhaltlich verfallen er und Co-Autor Béla Jarzyk, Schweigers ehemaliger Agent, an vielen Stellen althergebrachten Ideen, auch wenn der Fokus der Geschichte dieses Mal generell wieder stärker auf ihrem tragischen Aspekt liegt. Den Anfang macht hierbei die von Til Schweiger verkörperte Hauptfigur, bei der es sich einmal mehr um einen machohaften Womanizer handelt, der im Grunde aber herzensgut ist und dies durch zunehmend verantwortungsvolles und pflichtbewusstes Handeln letztendlich auch wieder nach außen kehren kann. Abgesehen von den damit verbundenen erneut zur Anwendung kommenden Erzählmustern eigener Produktionen hat sich Schweiger noch mehr als zuvor bei abgedroschenen Versatzstücken des Genres im Allgemeinen bedient. Spätestens wenn er es ein weiteres Mal für nötig hält, abgenutzte Klischees über geschlechterspezifisches Verhalten zum Besten zu geben, bekommt man den Eindruck, mit dem Dargebotenen schon anderswo zur Genüge konfrontiert gewesen zu sein.  Durch die Verwendung altbekannter Erzählmuster bleibt das Ende, auf das die Handlung zusteuert, nicht lange im Verborgenen. Das wäre grundsätzlich nicht weiter schlimm (war dies doch zum Beispiel im gelungenen «Keinohrhasen» auch nicht anders), wenn der Weg dorthin entsprechend packend und kurzweilig ausfallen und den Film somit trotz allem zu einem besonderen Erlebnis machen würde. Doch leider mangelt es «Kokowääh» an inhaltlichen Höhepunkten und erinnerungswürdigen Szenen, wie sie beispielsweise «Keinohrhasen» noch zuhauf bot. So kommt mit fortschreitender Handlung häufiger Langeweile auf. Dafür ist jedoch nicht die zentrale Vater-Tochter-Geschichte verantwortlich, gestaltet sich jene doch noch als vergleichsweise erfrischend, unterhaltsam und mit ihrem impliziten Plädoyer für das Funktionieren von Patchworkfamilien sogar recht modern. Am Leerlauf in der Handlung ist hingegen vielmehr die für Schweiger fast schon obligatorische Liebesgeschichte schuld, die diesmal nicht zuletzt aufgrund ihrer 08/15-Dramaturgie aufgesetzt wirkt und im Gesamtkontext des Films schlichtweg überflüssig ist. Obendrein entbehrt sie jeglicher Nachvollziehbarkeit, bleibt es doch ein Rätsel, was Henry abseits ihres Aussehens überhaupt an der neureichen selbstgefälligen Schriftstellerin findet, die einst ihre Prinzipien über Bord geworfen hat, um das große Geld zu machen. Da kann sich Jasmin Gerat noch so sehr anstrengen, wirklich sympathisch wird die von ihr verkörperte Katharina im gesamten Film nicht.
Durch die Verwendung altbekannter Erzählmuster bleibt das Ende, auf das die Handlung zusteuert, nicht lange im Verborgenen. Das wäre grundsätzlich nicht weiter schlimm (war dies doch zum Beispiel im gelungenen «Keinohrhasen» auch nicht anders), wenn der Weg dorthin entsprechend packend und kurzweilig ausfallen und den Film somit trotz allem zu einem besonderen Erlebnis machen würde. Doch leider mangelt es «Kokowääh» an inhaltlichen Höhepunkten und erinnerungswürdigen Szenen, wie sie beispielsweise «Keinohrhasen» noch zuhauf bot. So kommt mit fortschreitender Handlung häufiger Langeweile auf. Dafür ist jedoch nicht die zentrale Vater-Tochter-Geschichte verantwortlich, gestaltet sich jene doch noch als vergleichsweise erfrischend, unterhaltsam und mit ihrem impliziten Plädoyer für das Funktionieren von Patchworkfamilien sogar recht modern. Am Leerlauf in der Handlung ist hingegen vielmehr die für Schweiger fast schon obligatorische Liebesgeschichte schuld, die diesmal nicht zuletzt aufgrund ihrer 08/15-Dramaturgie aufgesetzt wirkt und im Gesamtkontext des Films schlichtweg überflüssig ist. Obendrein entbehrt sie jeglicher Nachvollziehbarkeit, bleibt es doch ein Rätsel, was Henry abseits ihres Aussehens überhaupt an der neureichen selbstgefälligen Schriftstellerin findet, die einst ihre Prinzipien über Bord geworfen hat, um das große Geld zu machen. Da kann sich Jasmin Gerat noch so sehr anstrengen, wirklich sympathisch wird die von ihr verkörperte Katharina im gesamten Film nicht. Wenn schon eine Nebenhandlung her muss, wäre es doch zum Beispiel eine ungleich spannendere Alternative gewesen, Henrys Beruf dazu zu nutzen, einen satirischen Blick auf das (deutsche) Filmgeschäft zu werfen. In einer Szene, in der sich Henry und Katharina mit dem unausstehlichen Regisseur der von ihnen geschriebenen Buchadaption treffen, hat dieser Ansatz sogar zum Teil Einzug in «Kokowääh» gefunden. Er hätte jedoch durchaus weiterverfolgt und ausgebaut werden können, um dem zentralen Konflikt ein auflockerndes Gegengewicht hinzuzusetzen, bei dem es sich zur Abwechslung mal nicht um eine Liebesgeschichte handelt. Aber das bleibt an dieser Stelle nur verspätetes Wunschdenken.
 Trotz aller Unzulänglichkeiten hat «Kokowääh» in Form von Samuel Finzi («Ein ganz gewöhnlicher Jude», «Flemming») jedoch auch ein echtes Highlight zu bieten. Mit seinem zurückhaltenden und dennoch überaus ausdrucksstarken Spiel weiß der gebürtige Bulgare die stille Verzweiflung eines Mannes ergreifend zu vermitteln, der nach acht Jahren plötzlich erfährt, dass die Tochter, zu der er eine innige Vaterliebe aufgebaut hat, gar nicht seine leibliche ist. Sein Wunsch, sich weiterhin um die nach wie vor von ihm geliebte Magdalena zu kümmern, wird von einem durch die neue Situation losgetretenen Gefühlschaos überschattet. Diese von Finzi nuanciert dargebotene tragische Hin- und Hergerissenheit sorgt für die wenigen wirklich rührenden Momente des Films.
Trotz aller Unzulänglichkeiten hat «Kokowääh» in Form von Samuel Finzi («Ein ganz gewöhnlicher Jude», «Flemming») jedoch auch ein echtes Highlight zu bieten. Mit seinem zurückhaltenden und dennoch überaus ausdrucksstarken Spiel weiß der gebürtige Bulgare die stille Verzweiflung eines Mannes ergreifend zu vermitteln, der nach acht Jahren plötzlich erfährt, dass die Tochter, zu der er eine innige Vaterliebe aufgebaut hat, gar nicht seine leibliche ist. Sein Wunsch, sich weiterhin um die nach wie vor von ihm geliebte Magdalena zu kümmern, wird von einem durch die neue Situation losgetretenen Gefühlschaos überschattet. Diese von Finzi nuanciert dargebotene tragische Hin- und Hergerissenheit sorgt für die wenigen wirklich rührenden Momente des Films.Ansonsten bleibt die Tragikomödie «Kokowääh» im Großen und Ganzen allerdings hinter ihren Möglichkeiten zurück. Die guten bis sehr guten Darstellerleistungen und das vielversprechende sowie streckenweise gut aufgehende Grundkonzept werden durch eine generelle Ideenarmut und eine zu viel Raum einnehmende, gezwungen wirkende Liebesgeschichte negativ überlagert. Das Ergebnis ist ein langatmiges, unausgegorenes Werk, das einen seine Handlung vorantreibenden roten Faden größtenteils vermissen lässt und einigen seiner eigenen Figuren erstaunlich fern bleibt.
«Kokowääh» ist seit dem 3. Februar in vielen deutschen Kinos zu sehen.






 Primetime-Check: Donnerstag, 3. Februar 2011
Primetime-Check: Donnerstag, 3. Februar 2011 Kairo-Berichterstattung: n-tv mit Erfolg
Kairo-Berichterstattung: n-tv mit Erfolg


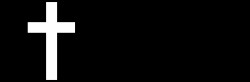







 Senior Video Producer/ 1st TV Operator (m/w/d)
Senior Video Producer/ 1st TV Operator (m/w/d) Pflicht-/Orientierungspraktikant Produktion (w/m/d)
Pflicht-/Orientierungspraktikant Produktion (w/m/d)



