1. Konsistenz/Verlässlichkeit
 «Cobra 11» steht für Action. Der «Tatort» fürs Mittüfteln. Und «Doctor’s Diary» für deutsche Comedy auf hohem Niveau. Serien – egal ob Krimi, Comedy oder Seifenoper – müssen eine starke Prämisse haben und verlässlich sein. Wir schalten ein, weil wir wissen, was wir bekommen.
«Cobra 11» steht für Action. Der «Tatort» fürs Mittüfteln. Und «Doctor’s Diary» für deutsche Comedy auf hohem Niveau. Serien – egal ob Krimi, Comedy oder Seifenoper – müssen eine starke Prämisse haben und verlässlich sein. Wir schalten ein, weil wir wissen, was wir bekommen. Um über Jahre Quote zu machen, muss diese Verlässlichkeit zum Template werden. Das beginnt mit dem Ton der Serie, der immer gleich ist. Wer es dunkler mag, schaut «Dexter», wer es lustig mag, «Friends». Oder doch lieber nachdenklich, reflektierend und auf der Suche nach dem Sinn des Lebens? Dann «Grey's Anatomy».
Neben der gewohnten Stimmung erwarten Zuschauer in jeder Folge ihre Stammcharaktere. Eine «Desperate Housewives»-Episode ohne Bree? Unvorstellbar. Genauso möchten die Zuschauer einen ganz bestimmten Anfang vorfinden – den, an den wir sie gewöhnt haben. Das kann ein Kameraschwenk über eine Siedlung sein oder eine Stimme aus dem Off, die über ein bestimmtes Thema reflektiert. Auch das Ende bitte wie immer: Als Resümee, mit Cliffhanger oder als komplett in sich geschlossene Geschichte.
Besonders wichtig ist die beständige Prämisse: «Danni Lowinski» handelt von einer Anwältin, die mit dem Herz am richtigen Fleck aber ungewöhnlichen Methoden den „kleinen Leuten“ zur Seite steht. Würde Danni plötzlich nur noch Fälle annehmen, die finanziell vielversprechend sind und sich benehmen, wie eine x-beliebige Anwältin, wäre die Serie tot.
2. Charaktere, die uns in ihren Bann ziehen
Serien sind Geschichten über Personen: «Dr. House» handelt von einem drogenabhängigen, schlechtgelaunten und unkonventionellen medizinischen Genie, der ein Team von Diagnostikern in einer Klinik leitet.
Wir brauchen Charaktere, derer wir nie überdrüssig werden. Die durch das, was sie tun, genauso charakterisiert werden, wie durch das, was sie nicht tun. Erfahrene Serienautoren schreiben ihre Charaktere so, dass sie uns wichtig werden. Dass wir mit ihnen fühlen und uns um sie sorgen. Dass wir an ihren Lippen hängen und dass sie uns fehlen, wenn die Staffel vorbei ist.
3. Beziehungen, die eine emotionale Story auslösen
Was wäre Carrie Bradshaw ohne Amanda, Charlotte und Miranda? Jennifer Anniston ohne ihre Freunde? Monk ohne seine Assistentin?
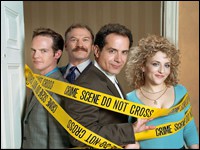 Unser normales Leben besteht daraus, Beziehungen zu führen, zu pflegen, sie zurückzufahren oder auszuweiten. Wenn wir sehen, wie andere Menschen jemanden beschenken, überraschen oder verzaubern, denken wir an unser eigenes Leben – und wen wir mal überrascht haben oder beschenken könnten. Wenn wir jemandem zusehen, der eine Freundschaft aus Kindertagen beendet, die überholt ist und nur zum Schein aufrecht erhalten wird, fragen wir uns: Müssten wir das nicht auch mal tun?
Unser normales Leben besteht daraus, Beziehungen zu führen, zu pflegen, sie zurückzufahren oder auszuweiten. Wenn wir sehen, wie andere Menschen jemanden beschenken, überraschen oder verzaubern, denken wir an unser eigenes Leben – und wen wir mal überrascht haben oder beschenken könnten. Wenn wir jemandem zusehen, der eine Freundschaft aus Kindertagen beendet, die überholt ist und nur zum Schein aufrecht erhalten wird, fragen wir uns: Müssten wir das nicht auch mal tun? Diese Möglichkeit zur Reflektion bindet uns an Serien. Es sind die Charaktere, mit denen wir fühlen, in Beziehungen, die uns an unser eigenes Leben erinnern. Serien, die das bieten, sind immer Quotengaranten.
4. Entwicklung ohne Entwicklung
Im Gegensatz zu Kinofilmen, die einen einzigen Anfang und ein einziges Ende haben, haben TV-Serien unzählige Anfänge und Enden. Schlüssel dabei ist das Wort „unzählig“. Denn da man nie weiß, wie lange eine Serie laufen wird, ist es wichtig, dass die Charaktere eine Entwicklung ohne Entwicklung durchmachen. Das heißt, dass sich eine Person immer wieder mit ein und demselben Thema beschäftigt: «Dr. House» mit diagnostisch schier unlösbaren Fällen genauso wie Gretchen Haase mit Marc Oliver Meier.
In jeder Episode lernt diese Person etwas dazu – aber nie so viel, dass sie alles weiß. Es gibt immer wieder offene Fragen, immer wieder neue Blickwinkel auf das gleiche Problem, immer neue Entwicklungsmöglichkeiten.
5. Original Content
 «Alles außer Sex» war eine Serie von ProSieben – der Versuch, «SATC» in ein deutsches Umfeld zu versetzen. Leider ohne die brillanten Dialoge des übermächtigen Vorbildes, ohne dessen Charme und deshalb auch ohne dessen Erfolg. Wie auch, wo Carrie Bradshaw ja Candice Bushnells Alter Ego ist und alleine schon deshalb eine ganz andere Strahlkraft besitzt.
«Alles außer Sex» war eine Serie von ProSieben – der Versuch, «SATC» in ein deutsches Umfeld zu versetzen. Leider ohne die brillanten Dialoge des übermächtigen Vorbildes, ohne dessen Charme und deshalb auch ohne dessen Erfolg. Wie auch, wo Carrie Bradshaw ja Candice Bushnells Alter Ego ist und alleine schon deshalb eine ganz andere Strahlkraft besitzt.Ein gelungenes Beispiel: «Berlin, Berlin» von David Safier. Die ARD-Vorabendserie gewann 2004 einen Emmy. Safier hatte eine originelle, eigene Idee, die er mit viel Liebe zum Detail und teils mutigen Entscheidungen wie den Lolle-Clips zum Erfolg geführt hat. «Berlin, Berlin» ist nicht „eine Serie wie“ oder „eine Mischung aus «Clueless» und «Friends»“, sondern etwas Eigenständiges, Großes. Und DAS hat dann auch international Erfolg und gewinnt Preise.
Auf der Suche nach neuen Aufgaben oder neuen Mitarbeitern? Uwe Walter empfiehlt Quotenmeter Jobs.






 NBC verschiebt Comedy-Starts
NBC verschiebt Comedy-Starts Die Kritiker: «Das Jahr des Drachen»
Die Kritiker: «Das Jahr des Drachen»










 Senior Video Producer/ 1st TV Operator (m/w/d)
Senior Video Producer/ 1st TV Operator (m/w/d) Pflicht-/Orientierungspraktikant Produktion (w/m/d)
Pflicht-/Orientierungspraktikant Produktion (w/m/d)



