 1. Die Charaktere: Wir wachsen mit ihnen auf, wir schließen sie in unser Herz, wir hassen sie, wir werden ihre Wegbegleiter. Schaut man eine Serie über Wochen und Monate – und über Jahre –, dann glaubt man, die Hauptcharaktere seiner Lieblingsserien in- und auswendig zu kennen. Sie werden vielleicht zu so etwas wie televisionären Freunden, zu denen man sich jede Woche und jedes Jahr zu einer neuen Staffel wieder gern auf die Couch setzt. Auch die Charaktere entwickeln sich weiter, über Monate und Jahre. Endet die Serie, blickt man wehmütig zurück: auf die vielen Stunden, die man mit ihnen verbracht hat, und vielleicht auch auf die Veränderungen im eigenen Leben in dieser langen Zeit. Es ist richtig schwer loszulassen. Binge watching ist dagegen so etwas wie fast food: Man lernt die Charaktere kurz und intensiv kennen, stillt seinen Serienhunger – aber zu den genannten jahrelangen televisionären Freunden werden die Figuren nicht, und auch das Loslassen geht einfacher von der hand. Es gibt eben Serien, die wollen langsam und langfristig konsumiert werden, «Mad Men» beispielsweise. Erst dann entfalten sie ihre ganze charakterliche Stärke.
1. Die Charaktere: Wir wachsen mit ihnen auf, wir schließen sie in unser Herz, wir hassen sie, wir werden ihre Wegbegleiter. Schaut man eine Serie über Wochen und Monate – und über Jahre –, dann glaubt man, die Hauptcharaktere seiner Lieblingsserien in- und auswendig zu kennen. Sie werden vielleicht zu so etwas wie televisionären Freunden, zu denen man sich jede Woche und jedes Jahr zu einer neuen Staffel wieder gern auf die Couch setzt. Auch die Charaktere entwickeln sich weiter, über Monate und Jahre. Endet die Serie, blickt man wehmütig zurück: auf die vielen Stunden, die man mit ihnen verbracht hat, und vielleicht auch auf die Veränderungen im eigenen Leben in dieser langen Zeit. Es ist richtig schwer loszulassen. Binge watching ist dagegen so etwas wie fast food: Man lernt die Charaktere kurz und intensiv kennen, stillt seinen Serienhunger – aber zu den genannten jahrelangen televisionären Freunden werden die Figuren nicht, und auch das Loslassen geht einfacher von der hand. Es gibt eben Serien, die wollen langsam und langfristig konsumiert werden, «Mad Men» beispielsweise. Erst dann entfalten sie ihre ganze charakterliche Stärke. 2. Der Watercooler-Effekt: Ob auf dem Schulhof, in Büro oder an der Uni: Das Gespräch über Serien gehörte einfach dazu. „Hast du den letzten «Tatort» gesehen?“ ist so eine Frage, die man montags oft zu hören bekommt – bei Serien aber kaum mehr. Denn durch das binge watching sind immer weniger Menschen auf dem gleichen inhaltlichen Stand. Manche haben die Serie schon zu Ende geguckt, manche gerade erst angefangen, andere bei der vorletzten Folge. Früher hat man sich dagegen über die letzte «Akte X»-Episode unterhalten und diskutierte wild drauf los. Heute läuft es oft nur auf die Feststellung hinaus: „Super Serie!“ – und das Gespräch ist beendet, wenn man nicht gerade zufällig auf demselben Stand ist. Das wiederkehrende, wöchentliche Ritual des Seriengenusses zur selben Uhrzeit am selben Feierabend entfällt. Und damit auch ein bisschen die Freude, am nächsten Tag das Gesehene einzuordnen.
3. Der Cliffhanger-Effekt: Binge watching hat zweifellos die Erzählweise und -struktur in modernen Qualitätsserien verändert. Netflix hat die Zeichen der Zeit als erstes erkannt und seine Formate direkt auf diese Art des Seriengenusses ausgerichtet: «House of Cards» wirkt beispielsweise eher wie ein mehrstündiger Film als eine Serie mit 13 Episoden. Die Narrative gewinnt dadurch die Freiheit, sich unabhängig von Sendeminuten zu machen. Aber der klassische Cliffhanger, den man ebenfalls lieben kann, entfällt – oder wird zumindest unwichtig: Denn selbst wenn es ihn gibt, ist die Auflösung nur einen Knopfdruck entfernt (außer eventuell beim Staffelfinale). Früher hat man stattdessen eine Woche warten müssen, bis die Geschichte weitergeht. Man hat hingefiebert auf die nächste Folge, hat sich – Stichwort Watercooler – mit Gleichgesinnten über den Cliffhanger ausgetauscht, vielleicht hat eine halbe Nation gespannt vor dem Fernseher auf die Auflösung gewartet. Viele Serien zogen ihre Spannung und ihren Reiz aus Cliffhangern, und manchmal gingen diese Fernsehmomente in die Popkultur-Geschichte ein: siehe J.R. Ewing und «Dallas», siehe «Twin Peaks». Es ist zumindest ein bisschen schade, dass im heutigen TV-Zeitalter solche Momente kaum mehr möglich scheinen.
 4. Feiertags-Episoden: Es gab früher nichts Schöneres, als eine Woche vor Weihnachten die neueste Episode seiner Lieblingsshow zu sehen. Die Chancen standen hoch, dass es eine Weihnachtsepisode ist. Besonders im Sitcom-Genre – Stichwort «King of Queens», «Frasier» und Co. – sind diese Festtagsfolgen beliebt: pathetisch, überzeichnet und einfach sentimental, aber gerade deswegen so schön. Dieses Gefühl kommt beim binge watching nicht mehr auf: Zwar versuchen sich auch typische Binge-Serien wie «Orange is the New Black» an Weihnachtsfolgen, aber die entsprechende Stimmung will natürlich nicht aufkommen, wenn man die Staffel im Hochsommer konsumiert. Dasselbe gilt für Halloween- oder Thanksgiving-Episoden. Binge-Serien sind dagegen zeitunabhängig, existieren in einem Raum abseits unseres jahreszeitlichen Alltags.
4. Feiertags-Episoden: Es gab früher nichts Schöneres, als eine Woche vor Weihnachten die neueste Episode seiner Lieblingsshow zu sehen. Die Chancen standen hoch, dass es eine Weihnachtsepisode ist. Besonders im Sitcom-Genre – Stichwort «King of Queens», «Frasier» und Co. – sind diese Festtagsfolgen beliebt: pathetisch, überzeichnet und einfach sentimental, aber gerade deswegen so schön. Dieses Gefühl kommt beim binge watching nicht mehr auf: Zwar versuchen sich auch typische Binge-Serien wie «Orange is the New Black» an Weihnachtsfolgen, aber die entsprechende Stimmung will natürlich nicht aufkommen, wenn man die Staffel im Hochsommer konsumiert. Dasselbe gilt für Halloween- oder Thanksgiving-Episoden. Binge-Serien sind dagegen zeitunabhängig, existieren in einem Raum abseits unseres jahreszeitlichen Alltags. 5. Die Wissenschaft: Je depressiver Menschen sind, desto eher neigen sie zum binge watching. Dies zumindest stellten drei Wissenschaftler der University of Texas fest, die in einer Studie 316 Menschen zwischen 18 und 29 Jahren befragten. Gefühle von Depression und Einsamkeit würden durch das Bingen unterdrückt – und damit ist übrigens nicht nur der exzessive Dauerkonsum von TV-Serien gemeint, sondern auch das übermäßige Essen (binge-eating) und Trinken (binge-drinking). Aber Achtung, Statistikfans: Es liegt lediglich eine Korrelation vor, keine Ursache-Wirkungs-Beziehung. Das heißt, dass binge watching weder Depressionen auslöst noch dass es eine Folge oder ein Anzeichen von Depressionen ist. Sondern nur, dass Depressive eher zu entsprechenden exzessiven Handlungen neigen. Sprich: Die nächste «House of Cards»-Staffel kann ruhig kommen. Auch ohne Antidepressiva.

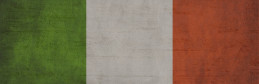



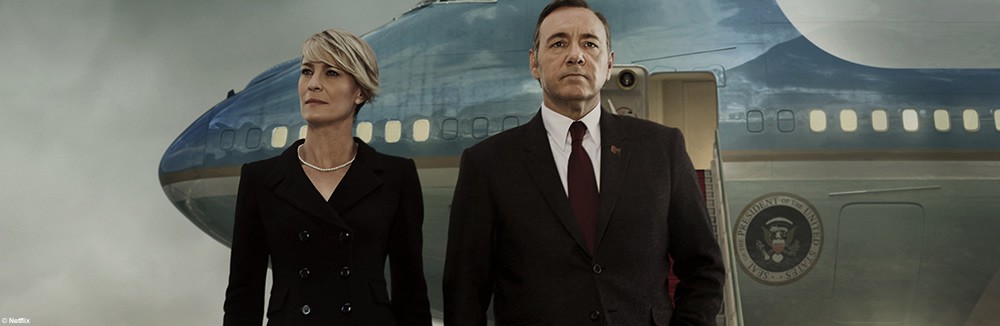


 N24 feiert «Star Wars»-Kinostart mit eigener «Star Night»
N24 feiert «Star Wars»-Kinostart mit eigener «Star Night» «Ponyhof»: Unverblümt, chaotisch, mehr davon!
«Ponyhof»: Unverblümt, chaotisch, mehr davon!



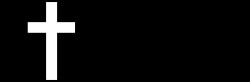






 Senior Video Producer/ 1st TV Operator (m/w/d)
Senior Video Producer/ 1st TV Operator (m/w/d) Pflicht-/Orientierungspraktikant Produktion (w/m/d)
Pflicht-/Orientierungspraktikant Produktion (w/m/d)



