 «Unser Walter» wurde am 08. Juli 1974 im ZDF geboren und entstand zu einer Zeit, als die deutsche Bevölkerung langsam begann, ihr starres und enges Korsett der Kriegs- bzw. Nachkriegszeit abzulegen. Zunehmend wichen konservative und zum Teil menschenverachtende Ansichten einer sich verbreitenden Toleranz gegenüber anderen Lebensweisen und anderen Menschen. Insbesondere in der Pädagogik setzten sich alternative Konzepte und die Einsicht durch, dass alle Menschen das gleiche Recht auf Bildung, Förderung und soziale Teilhabe haben. Einen dunklen Fleck stellten jedoch weiterhin Menschen mit Behinderungen dar, die auch zu Beginn der 70er Jahre nur in Ausnahmefällen integriert waren. Stattdessen wurden sie für gewöhnlich von der übrigen Bevölkerung in eigenen Einrichtungen, Anstalten oder Sonderschulen ferngehalten, wodurch kaum Berührungspunkte zu Stande kamen und viele Vorurteile und Ressentiments kursierten. Ganz besonders deutlich bekamen dies Menschen mit geistiger Beeinträchtigung oder verzögerter Entwicklung zu spüren.
«Unser Walter» wurde am 08. Juli 1974 im ZDF geboren und entstand zu einer Zeit, als die deutsche Bevölkerung langsam begann, ihr starres und enges Korsett der Kriegs- bzw. Nachkriegszeit abzulegen. Zunehmend wichen konservative und zum Teil menschenverachtende Ansichten einer sich verbreitenden Toleranz gegenüber anderen Lebensweisen und anderen Menschen. Insbesondere in der Pädagogik setzten sich alternative Konzepte und die Einsicht durch, dass alle Menschen das gleiche Recht auf Bildung, Förderung und soziale Teilhabe haben. Einen dunklen Fleck stellten jedoch weiterhin Menschen mit Behinderungen dar, die auch zu Beginn der 70er Jahre nur in Ausnahmefällen integriert waren. Stattdessen wurden sie für gewöhnlich von der übrigen Bevölkerung in eigenen Einrichtungen, Anstalten oder Sonderschulen ferngehalten, wodurch kaum Berührungspunkte zu Stande kamen und viele Vorurteile und Ressentiments kursierten. Ganz besonders deutlich bekamen dies Menschen mit geistiger Beeinträchtigung oder verzögerter Entwicklung zu spüren. Diese Zustände ärgerten den Autor Heiner Michel so sehr, dass er ein bis dahin einmaliges Projekt initiierte. Anstatt das heikle Thema nämlich in einer weiteren verkopften Dokumentation aufzuarbeiten, wollte er die Zuschauenden durch die Mittel einer „normalen Spielserie“ auf einer emotionalen Ebene erreichen. So entstand eine Serie, in der es um Walter Zabel ging, einen Jungen mit Down-Syndrom. Aufgrund der mit einer solchen Trisomie 21 meist verbundenen Entwicklungsverzögerung und aufgrund der typischen Gesichtszüge wurden (und werden) Menschen mit dieser Genabweichung häufig ausgegrenzt, diskriminiert und als „mongoloid“ oder „schwachsinnig“ deklassiert. Die sieben Episoden umfassten dann Walters Entwicklung vom zweiten bis zum 21. Lebensjahr und somit eine Zeitspanne von 1955 bis 1974. Neben seiner Älterwerdung bildete die Handlung zugleich die jeweiligen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und gängigen (ablehnenden) Reaktionen der Bevölkerung gegenüber Menschen mit Behinderungen und ihren Familien ab.
Diese Zustände ärgerten den Autor Heiner Michel so sehr, dass er ein bis dahin einmaliges Projekt initiierte. Anstatt das heikle Thema nämlich in einer weiteren verkopften Dokumentation aufzuarbeiten, wollte er die Zuschauenden durch die Mittel einer „normalen Spielserie“ auf einer emotionalen Ebene erreichen. So entstand eine Serie, in der es um Walter Zabel ging, einen Jungen mit Down-Syndrom. Aufgrund der mit einer solchen Trisomie 21 meist verbundenen Entwicklungsverzögerung und aufgrund der typischen Gesichtszüge wurden (und werden) Menschen mit dieser Genabweichung häufig ausgegrenzt, diskriminiert und als „mongoloid“ oder „schwachsinnig“ deklassiert. Die sieben Episoden umfassten dann Walters Entwicklung vom zweiten bis zum 21. Lebensjahr und somit eine Zeitspanne von 1955 bis 1974. Neben seiner Älterwerdung bildete die Handlung zugleich die jeweiligen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und gängigen (ablehnenden) Reaktionen der Bevölkerung gegenüber Menschen mit Behinderungen und ihren Familien ab. Neben Heiner Michel und einigen Medizinern waren an der Entstehung der Drehbücher ebenso der evangelische Pfarrer Ernst Wörle und dessen Ehefrau beteiligt, die selbst ein Kind mit Down-Syndrom versorgten. Zusätzlich wurde das Skript von weiteren Eltern abgesegnet, die über ähnliche Erfahrungen mit betroffenen Kindern verfügten. Das erklärte Ziel war es schließlich, die Verhältnisse möglichst realistisch darzustellen. Dies war auch der Grund, wieso man sich dafür entschied, die Figur des Walter von Menschen darstellen zu lassen, die tatsächlich das Down-Syndrom hatten. Für die einzelnen Abschnitte, die sich jeweils verschiedenen Entwicklungsstadien von Walter widmeten, schlüpften daher sechs Kinder und Jugendliche mit Trisomie 21 in dieselbe Rolle. Einer von ihnen war übrigens der Sohn von Pfarrer Wörle, der Walter hieß und als Vorlage für die gesamte Sendung diente.
Neben Heiner Michel und einigen Medizinern waren an der Entstehung der Drehbücher ebenso der evangelische Pfarrer Ernst Wörle und dessen Ehefrau beteiligt, die selbst ein Kind mit Down-Syndrom versorgten. Zusätzlich wurde das Skript von weiteren Eltern abgesegnet, die über ähnliche Erfahrungen mit betroffenen Kindern verfügten. Das erklärte Ziel war es schließlich, die Verhältnisse möglichst realistisch darzustellen. Dies war auch der Grund, wieso man sich dafür entschied, die Figur des Walter von Menschen darstellen zu lassen, die tatsächlich das Down-Syndrom hatten. Für die einzelnen Abschnitte, die sich jeweils verschiedenen Entwicklungsstadien von Walter widmeten, schlüpften daher sechs Kinder und Jugendliche mit Trisomie 21 in dieselbe Rolle. Einer von ihnen war übrigens der Sohn von Pfarrer Wörle, der Walter hieß und als Vorlage für die gesamte Sendung diente. Um zugleich eine größtmögliche Beachtung beim Publikum zu erhalten, ging Autor Michel sehr clever vor, denn er stellte mit den Zabels eine gutbürgerliche Familie in das Zentrum des Geschehens, die ein mittelständiges Milchgeschäft in München führte und brav ihren Anteil am deutschen Bruttosozialprodukt erwirtschaftete. Auf den ersten Blick reihte sich «Unser Walter» deshalb in den Reigen der damaligen, typischen Familienserien ein. Aber so sehr die Zabels zu Beginn der Geschichte wie eine typisch-deutsche Vorzeigefamilie wirkten, so schnell änderte sich ihr Status, als bei ihrem zweieinhalbjährigen Sohn die Diagnose „Mongolismus“ gestellt wurde. Sie mussten anschließend zusammen mit den Zuschauenden lernen, dass Walter deutlich mehr Aufmerksamkeit, Anstrengung und Förderung benötigen würde als zunächst angenommen. Nicht nur die damit verbundene Mehrbelastung bedrohte bald die Existenz des Familiengeschäfts, sondern ebenso die Vorbehalte der Nachbarschaft, die wegen Walter den Milchladen mieden.
Um zugleich eine größtmögliche Beachtung beim Publikum zu erhalten, ging Autor Michel sehr clever vor, denn er stellte mit den Zabels eine gutbürgerliche Familie in das Zentrum des Geschehens, die ein mittelständiges Milchgeschäft in München führte und brav ihren Anteil am deutschen Bruttosozialprodukt erwirtschaftete. Auf den ersten Blick reihte sich «Unser Walter» deshalb in den Reigen der damaligen, typischen Familienserien ein. Aber so sehr die Zabels zu Beginn der Geschichte wie eine typisch-deutsche Vorzeigefamilie wirkten, so schnell änderte sich ihr Status, als bei ihrem zweieinhalbjährigen Sohn die Diagnose „Mongolismus“ gestellt wurde. Sie mussten anschließend zusammen mit den Zuschauenden lernen, dass Walter deutlich mehr Aufmerksamkeit, Anstrengung und Förderung benötigen würde als zunächst angenommen. Nicht nur die damit verbundene Mehrbelastung bedrohte bald die Existenz des Familiengeschäfts, sondern ebenso die Vorbehalte der Nachbarschaft, die wegen Walter den Milchladen mieden. Dadurch zeigte die Produktion ein Bild von Deutschland, in dem Walter und seine Eltern nahezu pausenlos Ablehnungen und Meidungen erleiden und gegen unzählige Barrieren ankämpfen mussten – sei es nun, um einen Platz in einer Kindertagesstätte zu bekommen, um in einem Lokal bedient zu werden oder um an einer Jugendfreizeit teilzunehmen. Zugleich waren die Eltern selbst mit starken Unsicherheiten konfrontiert und standen unter derart großem gesellschaftlichen Druck, dass sie mehrfach ihren Sohn verleugneten. Die Handlung arbeitete dabei eine Auswahl typischer Konfliktsituationen oder Alltagsherausforderungen ab und durchlief die verschiedenen emotionalen Phasen der Eltern - von der anfänglichen Ablehnung ihres Sohnes bis zu seiner vollständigen Anerkennung.
Dadurch zeigte die Produktion ein Bild von Deutschland, in dem Walter und seine Eltern nahezu pausenlos Ablehnungen und Meidungen erleiden und gegen unzählige Barrieren ankämpfen mussten – sei es nun, um einen Platz in einer Kindertagesstätte zu bekommen, um in einem Lokal bedient zu werden oder um an einer Jugendfreizeit teilzunehmen. Zugleich waren die Eltern selbst mit starken Unsicherheiten konfrontiert und standen unter derart großem gesellschaftlichen Druck, dass sie mehrfach ihren Sohn verleugneten. Die Handlung arbeitete dabei eine Auswahl typischer Konfliktsituationen oder Alltagsherausforderungen ab und durchlief die verschiedenen emotionalen Phasen der Eltern - von der anfänglichen Ablehnung ihres Sohnes bis zu seiner vollständigen Anerkennung.So reagierte Vater Zabel anfangs völlig unverständlich auf die Diagnose des Arztes und forderte: „Der Junge muss wieder in Ordnung kommen, wir haben doch den Laden.“ Zugleich schob er seiner Frau die Schuld zu, da er zuvor in einem Lexikon gelesen hatte, die Ursache würde oft in einer Fehlfunktion der weiblichen Eierstöcke liegen. In diese gegenseitige Schuldzuweisung stimmten Walters Großeltern mit ein, weil auch sie sich vorwarfen, dass Walter seinen Zustand aus dem jeweils anderen Teil der Familie geerbt haben musste. Der Streit fand seinen traurigen Höhepunkt in der Feststellung, dass man genau deswegen im Dritten Reich stets den Erbfaktor untersucht und es „so etwas“ damals nicht gegeben hätte.
 Ähnlich reagierten die Männer an Vater Zabels Stammtisch auf einen anderen Jungen mit spastischen Lähmungen: „Wer schon so ein Kind hat, soll es zu Hause lassen. Das ist doch kein Anblick.“ Oder, man sollte es bereits „bei der Geburt wegmachen lassen“, weil es „nur der Allgemeinheit zur Last“ fallen würde. Zum Abschluss billigten sie rückwirkend noch die Euthanasie-Politik der Nationalsozialisten mit dem Hinweis: „Alles war auch nicht schlecht, was damals bei Adolf gemacht wurde. Für solch einen ist die Spritze doch eine Erlösung.“
Ähnlich reagierten die Männer an Vater Zabels Stammtisch auf einen anderen Jungen mit spastischen Lähmungen: „Wer schon so ein Kind hat, soll es zu Hause lassen. Das ist doch kein Anblick.“ Oder, man sollte es bereits „bei der Geburt wegmachen lassen“, weil es „nur der Allgemeinheit zur Last“ fallen würde. Zum Abschluss billigten sie rückwirkend noch die Euthanasie-Politik der Nationalsozialisten mit dem Hinweis: „Alles war auch nicht schlecht, was damals bei Adolf gemacht wurde. Für solch einen ist die Spritze doch eine Erlösung.“Solche schwer erträglichen Sätze und Situationen durchzogen das gesamte Format, das geradezu pervers-akribisch jede Form der Zurückweisung durchdeklinierte. Das war in erster Linie der Tatsache geschuldet, dass es größtenteils Mitte der Fünfziger und zu Beginn der Sechziger spielte, wo Hitlers Politik in den Überlebenden noch beharrlich nachwirkte. Genauso klar ist, dass die konservative, bürgerliche Schicht teilweise überspitzt dargestellt wurde, um solche Missstände verdeutlichen und das aufklärerische Ziel verfolgen zu können.
 In diesem Erziehungsauftrag lag zugleich die größte Schwäche des Konzepts. So sehr seine ambitionierte Absicht zu unterstützen war, so didaktisch schwerfällig und unnatürlich kam das Ergebnis daher. Dafür war hauptsächlich der negativ-pädagogische Ansatz, verantwortlich, durch den vorranging negative Situationen gezeigt wurden. Nur selten erfuhren Walter und die Zabels Hilfe oder Verständnis. Nur selten sah das Publikum, wie man sich besser verhalten kann. Nur selten konnte es sich über heitere Szenen freuen. Dieser permanent erhobene, pädagogische Zeigefinger mochte abschreckend und daher wirksam erscheinen, doch basierte er auf Mitleid oder einem schlechten Gewissen und demonstrierte nicht, welche Bereicherung ein Kind wie Walter für seine Mitmenschen darstellen kann. Darüber hinaus blieb der Junge bei alldem nur ein Statist, über den hauptsächlich geredet wurde. Zu keiner Zeit wechselte die Erzählung in seine Perspektive oder schilderte seine Welt. Im Grunde war «Unser Walter» keine Story über einen Menschen mit Behinderung, sondern lediglich über dessen Angehörige.
In diesem Erziehungsauftrag lag zugleich die größte Schwäche des Konzepts. So sehr seine ambitionierte Absicht zu unterstützen war, so didaktisch schwerfällig und unnatürlich kam das Ergebnis daher. Dafür war hauptsächlich der negativ-pädagogische Ansatz, verantwortlich, durch den vorranging negative Situationen gezeigt wurden. Nur selten erfuhren Walter und die Zabels Hilfe oder Verständnis. Nur selten sah das Publikum, wie man sich besser verhalten kann. Nur selten konnte es sich über heitere Szenen freuen. Dieser permanent erhobene, pädagogische Zeigefinger mochte abschreckend und daher wirksam erscheinen, doch basierte er auf Mitleid oder einem schlechten Gewissen und demonstrierte nicht, welche Bereicherung ein Kind wie Walter für seine Mitmenschen darstellen kann. Darüber hinaus blieb der Junge bei alldem nur ein Statist, über den hauptsächlich geredet wurde. Zu keiner Zeit wechselte die Erzählung in seine Perspektive oder schilderte seine Welt. Im Grunde war «Unser Walter» keine Story über einen Menschen mit Behinderung, sondern lediglich über dessen Angehörige.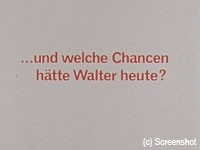 Dazu gesellte sich eine äußerst spröde Inszenierung. Auf den Einsatz von Musik als Stilmittel wurde beispielsweise vollends verzichtet und die Szenen waren ohne jegliche übergreifende Dramatik aneinandergereiht. Das Ergebnis wirkte eher wie ein Aufklärungsfilm und weniger wie eine Familienserie. Zudem waren die einzelnen Vorfälle zu plakativ, voneinander isoliert und zu konstruiert. Das war bis zu einem gewissen Grad dem damaligen Zeitgeist und den Sehgewohnheiten geschuldet, doch wirkte jene Unnatürlichkeit und Schwere der beabsichtigten emotionalen Wirkung entgegen. Unterstützt wurde dieser Eindruck durch den Umstand, dass jedem Kapitel ein Erklärstück folgte, in dem damals aktuelle Möglichkeiten und Entwicklungen für Menschen wie Walter vorgestellt und ein stärkeres Bewusstsein sowie finanzielle Unterstützung für die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen gefordert wurden. Diese steife Umsetzung benannte im Jahr 1999 der damalige ZDF-Programmdirektor Markus Schächter auch als Begründung dafür, wieso die Reihe anlässlich ihres 25jährigen Jubiläums nicht in der Primetime wiederholt werden konnte. Demnach wäre dies „undurchführbar“ gewesen, weil die „Erzählform nicht mehr den heutigen Rezeptionsgewohnheiten entspricht“.
Dazu gesellte sich eine äußerst spröde Inszenierung. Auf den Einsatz von Musik als Stilmittel wurde beispielsweise vollends verzichtet und die Szenen waren ohne jegliche übergreifende Dramatik aneinandergereiht. Das Ergebnis wirkte eher wie ein Aufklärungsfilm und weniger wie eine Familienserie. Zudem waren die einzelnen Vorfälle zu plakativ, voneinander isoliert und zu konstruiert. Das war bis zu einem gewissen Grad dem damaligen Zeitgeist und den Sehgewohnheiten geschuldet, doch wirkte jene Unnatürlichkeit und Schwere der beabsichtigten emotionalen Wirkung entgegen. Unterstützt wurde dieser Eindruck durch den Umstand, dass jedem Kapitel ein Erklärstück folgte, in dem damals aktuelle Möglichkeiten und Entwicklungen für Menschen wie Walter vorgestellt und ein stärkeres Bewusstsein sowie finanzielle Unterstützung für die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen gefordert wurden. Diese steife Umsetzung benannte im Jahr 1999 der damalige ZDF-Programmdirektor Markus Schächter auch als Begründung dafür, wieso die Reihe anlässlich ihres 25jährigen Jubiläums nicht in der Primetime wiederholt werden konnte. Demnach wäre dies „undurchführbar“ gewesen, weil die „Erzählform nicht mehr den heutigen Rezeptionsgewohnheiten entspricht“. Dass man ein solches Projekt aus heutiger Sicht anders ausrichten würde, schmälert aber in keiner Weise den enormen Mut und das große Engagement, dass das Team um Heiner Michel damals bewiesen hat. Zweifelsfrei hat das Programm zu einem besseren Verständnis für das Down-Syndrom und für Menschen mit Behinderung beigetragen sowie eine öffentliche Debatte darüber angestoßen. Richtigerweise wurde es deswegen mit dem Grimme-Preis, dem Bambi in Gold und weiteren Auszeichnungen prämiert. Obwohl die Serie bloß einen unregelmäßigen Ausstrahlungsrhythmus mit mehrwöchigen Pausen zwischen den einzelnen Folgen erhielt, bewegte sie ein großes Publikum. Die 45minütigen Episoden flimmerten in Westdeutschland am Montagabend um 19.30 Uhr auf vier bis sechs Millionen eingeschalteten Fernsehgeräten. Dies entsprach in der Spitze einem Marktanteil von 40 Prozent, was angesichts des Inhalts und der trägen Gestaltung einen beachtlichen Erfolg darstellte. Welche positiven Reaktionen die Erlebnisse der Familie Zabel bei den Zuschauenden auslösten, bewiesen unzählige beim ZDF eingegangene Briefe, in denen sich betroffene Eltern dafür bedankten, ihre Kinder jetzt nicht mehr verstecken zu müssen.
Dass man ein solches Projekt aus heutiger Sicht anders ausrichten würde, schmälert aber in keiner Weise den enormen Mut und das große Engagement, dass das Team um Heiner Michel damals bewiesen hat. Zweifelsfrei hat das Programm zu einem besseren Verständnis für das Down-Syndrom und für Menschen mit Behinderung beigetragen sowie eine öffentliche Debatte darüber angestoßen. Richtigerweise wurde es deswegen mit dem Grimme-Preis, dem Bambi in Gold und weiteren Auszeichnungen prämiert. Obwohl die Serie bloß einen unregelmäßigen Ausstrahlungsrhythmus mit mehrwöchigen Pausen zwischen den einzelnen Folgen erhielt, bewegte sie ein großes Publikum. Die 45minütigen Episoden flimmerten in Westdeutschland am Montagabend um 19.30 Uhr auf vier bis sechs Millionen eingeschalteten Fernsehgeräten. Dies entsprach in der Spitze einem Marktanteil von 40 Prozent, was angesichts des Inhalts und der trägen Gestaltung einen beachtlichen Erfolg darstellte. Welche positiven Reaktionen die Erlebnisse der Familie Zabel bei den Zuschauenden auslösten, bewiesen unzählige beim ZDF eingegangene Briefe, in denen sich betroffene Eltern dafür bedankten, ihre Kinder jetzt nicht mehr verstecken zu müssen. Trotz aller Fortschritte, die seit der Premiere von «Unser Walter» erreicht wurden, ist eine vollkommene Anerkennung und Gleichbehandlung von Menschen mit Trisomie 21 längst nicht umgesetzt. Noch immer hält sich der längst überholte Begriffe „Mongolismus“ beharrlich. Noch immer wird häufig irrtümlich von einer Krankheit gesprochen (selbst im offiziellen Online-Duden). Und noch immer berichten betroffene Eltern davon, sich dafür rechtfertigen zu müssen, ihr Kind nicht abgetrieben zu haben. Noch viel zu oft, werden sie weiterhin in gesonderten Einrichtungen und Schulen vom sozialen Leben ausgesperrt. Einzig die vollständige Inklusion – also beispielsweise eine gemeinsame Unterrichtung von Menschen mit und ohne Behinderung – kann Ängste abbauen sowie einen vorurteilsfreien Umgang miteinander ermöglichen. Zu einer dafür nötigen breiten Akzeptanz von Menschen mit Behinderungen können dann Serien wie «Unser Walter» oder andere Formate wie «selbstbestimmt!» (MDR), «Challenge» (Kabel eins) oder «Guildo und seine Gäste» (SWR) im Fernsehen beitragen. Man darf nie vergessen: Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den schwächsten ihrer Glieder verfährt.
Trotz aller Fortschritte, die seit der Premiere von «Unser Walter» erreicht wurden, ist eine vollkommene Anerkennung und Gleichbehandlung von Menschen mit Trisomie 21 längst nicht umgesetzt. Noch immer hält sich der längst überholte Begriffe „Mongolismus“ beharrlich. Noch immer wird häufig irrtümlich von einer Krankheit gesprochen (selbst im offiziellen Online-Duden). Und noch immer berichten betroffene Eltern davon, sich dafür rechtfertigen zu müssen, ihr Kind nicht abgetrieben zu haben. Noch viel zu oft, werden sie weiterhin in gesonderten Einrichtungen und Schulen vom sozialen Leben ausgesperrt. Einzig die vollständige Inklusion – also beispielsweise eine gemeinsame Unterrichtung von Menschen mit und ohne Behinderung – kann Ängste abbauen sowie einen vorurteilsfreien Umgang miteinander ermöglichen. Zu einer dafür nötigen breiten Akzeptanz von Menschen mit Behinderungen können dann Serien wie «Unser Walter» oder andere Formate wie «selbstbestimmt!» (MDR), «Challenge» (Kabel eins) oder «Guildo und seine Gäste» (SWR) im Fernsehen beitragen. Man darf nie vergessen: Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den schwächsten ihrer Glieder verfährt.Mögen solche Bemühungen niemals ruhen!
Die nächste Ausgabe des Fernsehfriedhofs erscheint am Donnerstag, den 24. Dezember 2015.








 TNT stiftet zu weiteren Verbrechen an
TNT stiftet zu weiteren Verbrechen an «Schulz und Böhmermann» überbrückt die «neo Magazin»-Pause
«Schulz und Böhmermann» überbrückt die «neo Magazin»-Pause









 Producer/Executive Producer (m/w/d) im Bereich Reality am Standort Köln
Producer/Executive Producer (m/w/d) im Bereich Reality am Standort Köln Senior Video Producer/ 1st TV Operator (m/w/d)
Senior Video Producer/ 1st TV Operator (m/w/d) Pflicht-/Orientierungspraktikant Produktion (w/m/d)
Pflicht-/Orientierungspraktikant Produktion (w/m/d)



